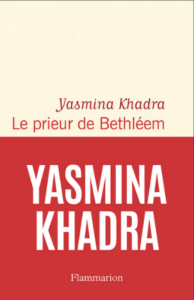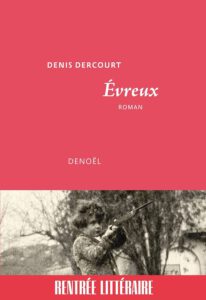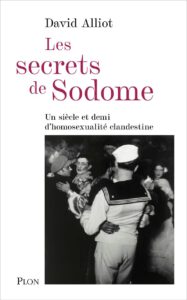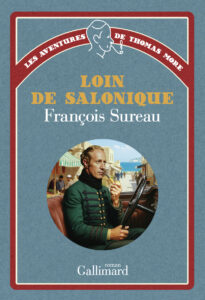Land der Kinderkönige: Palästina zwischen Gewalt und Gnade bei Yasmina Khadra
Yasmina Khadras neuer Roman „Le prieur de Bethléem“ (Flammarion, 2026, zit. als PB) knüpft thematisch an seine sogenannte „Trilogie des großen Missverständnisses“ an, die eine literarische Kartografie der Krisenregionen der frühen 2000er Jahre entwarf, Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban (mit „Die Schwalben von Kabul“), Israel und die palästinensischen Gebiete während der Zweiten Intifada (in „Die Attentäterin“) und Irak im Kontext des Irakkriegs nach der amerikanischen Invasion 2003 (in „Die Sirenen von Bagdad“). Wie in diesen Romanen verbindet Khadra auch hier eine spannungsreiche Handlung mit einer moralischen Reflexion über Gewalt, Demütigung und Radikalisierung. Im Zentrum steht der französisch-israelische Verleger Alexandre Yakovlevoï, der ein Manuskript eines palästinensischen Mönchs erhält und kurz darauf von dessen Autor entführt wird. Während Alexandre gezwungen wird, die Lebensgeschichte des Priors Wahid anzuhören – eine Chronik von Vertreibung, familiären Verlusten und politischer Gewalt in Palästina –, enthüllt sich allmählich eine persönliche Verstrickung: Alexandre selbst war als junger Soldat in Israel an der Tötung von Wahids schwangeren Cousine beteiligt. Der Roman entwickelt daraus eine Konfrontation, die nicht auf Rache zielt, sondern auf moralische Einsicht. Parallel dazu öffnen visionäre und fast messianische Szenen – etwa geheimnisvolle Heilungen in Jordanien oder die Erscheinung eines Pilgers in den Ruinen von Gaza – eine spirituelle Perspektive, in der Khadra den Konflikt in einen universalen Horizont menschlicher Verantwortung stellt. – Der Aufsatz interpretiert den Roman als späte Weiterführung der Trilogie, die deren Diagnose des „großen Missverständnisses“ zwischen Orient und Okzident vertieft und zugleich transformiert. Während die früheren Werke vor allem die Entstehung von Gewalt aus Demütigung und politischer Ohnmacht analysierten, verschiebt sich hier der Fokus auf eine moralische Konfrontation zwischen Täter und Opfer. Die Argumentation des Aufsatzes arbeitet dabei mehrere Ebenen heraus: erstens die politische Dimension des Romans als Kritik an militärischer Gewalt und asymmetrischer Wahrnehmung des Nahostkonflikts; zweitens die psychologische Struktur der Schuld, die sich in der Figur des französisch-israelischen Verlegers verdichtet; und drittens eine religiös-symbolische Ebene, auf der Khadra eine Vision moralischer Wiedergeburt entwirft. Besonders betont wird, dass der Roman nicht im politischen Realismus stehen bleibt, sondern eine utopische Gegenbewegung formuliert: Wahrheit, Empathie und die „rettende Geste“ erscheinen als Möglichkeiten, den Kreislauf von Trauma und Vergeltung zu durchbrechen. Die Interpretation liest PB daher weniger als politischen Roman im engeren Sinn, sondern als literarischen Versuch des Dégagement, den Nahostkonflikt in eine universelle Ethik der Menschlichkeit zu überführen.
➙ Zum Artikel