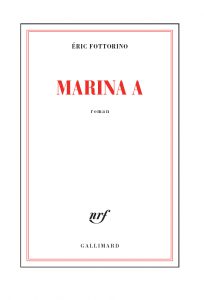Certains soirs, ou avant de m’endormir, je m’étais mis à revivre notre voyage passé à Florence, avec la sensation que jamais nous ne connaîtrions à nouveau pareils moments d’insouciance et d’harmonie. Ils appartenaient à hier, sans espoir de retour. Ce sentiment de perte m’oppressait. Nous avions vécu comme une expérience normale ce qui ne l’était pas. Un des derniers moments de nos vies d’avant, sans que personne ne nous ait alertés. Personne à moins que Marina A, avec ses performances énigmatiques aux apparences gratuites ou absurdes, ne nous eût montré une voie aux contours énigmatiques. La fragilité des corps face à des dangers insaisissables, notre mortalité de feuilles légères accrochées au fil de la vie quand on nous promettait l’éternité bionique.
Quelqu’un avait dit, j’ignorais son nom, que la vie n’était qu’un rêve, et que la mort sonnait notre réveil. Il m’arrivait de rêver que je retournais à Florence sans Maud ni Lisa. C’était le même voyage que je revivais, à cette différence près que je me retrouvais seul dans les rues du vieux centre, seul sur les rives étincelantes de l’Arno, sur les chemins des jardins de Boboli que je dévalais à perdre haleine, au musée des Offices, devant le Duomo où, étrangement, des prêtres installés sous de petites tentes confessaient de rares fidèles au volant de leurs voitures, tous masqués et à bonne distance, dans une transaction de péchés dont les uns délivraient les autres. Plus exactement, il semblait que les fidèles délivraient les prêtres de leurs fautes. Mon cœur battait anormalement. Je traversais les places en courant, la piazza della Signoria qu’on avait tant de fois parcourue ensemble avant de s’asseoir fourbus sur une banquette en cuir du café Rivoire. J’étais un fou qui sentait la vie le quitter en déambulant le long des artères vides menant au Ponte Vecchio, ou dans les palais des Médicis avec leurs tombeaux, à l’affût des sensations d’autrefois, quand la ville bruissait de rires, de flashs et de jeux d’eau. Je poussais les portes des églises désertes, appelais Maud et Lisa, en vain. J’éprouvais ce que Stendhal avait paraît-il appelé le syndrome de Florence, un éblouissement violent à donner le tournis, un mélange de panique et d’extase, la rencontre de la grâce et des ténèbres, la douleur qu’inflige l’art quand sa beauté irregardable vous assomme. Dans mes rêves, ceux dont me restaient quelques bribes au réveil comme entre mes doigts un sable d’or, je me retrouvais seul avec Marina. Parfois c’est elle que j’apercevais au détour d’une rue, dans les reflets de vitrines vides, dans une traîne blanche de mariée ou rouge ensanglantée. Parfois c’était juste son ombre furtive que je voyais glisser dans un filament de lumière.
Peu à peu ces visions crépusculaires agirent comme un révélateur photographique sur des sels d’argent. Les images latentes que j’avais gardées en moi des apparitions de Marina à Florence se firent plus nettes. Mon pressentiment devint tangible, presque palpable, à portée de main écorchée. Je revoyais les expressions de peur collective face à l’artiste se mutilant au couteau. Puis l’évidence me saisit un matin de sommeil agité. La prise de distance de Marina avec Ulay, comme avec ses innombrables visiteurs du MoMA, n’annonçait rien de moins que le premier de nos gestes barrières.
À l’hôpital on avait reporté les opérations à des jours meilleurs. Après une intervention urgente sur un garçonnet atteint d’un rhume aigu de la hanche – ne pas le ponctionner l’aurait menacé d’une boiterie indélébile –, je me mis en congé forcé sine die. Mon équipe savait qu’à tout moment elle pourrait me solliciter. On était entrés dans l’épidémie qu’on appelait déjà pandémie, certains avec un « P » majuscule défiant le « A » de Marina Abramovic. À mesure que nos visages disparaissaient derrière des masques pas vraiment carnavalesques, et comme les consignes sanitaires s’apparentaient à des performances qui nous auraient paru insensées un mois avant – se tenir à un mètre des autres, se moucher dans son coude, se laver les mains à tout bout de champ, ne plus rien toucher dans l’espace public, effacer en toutes circonstances ou presque la moitié de nos visages –, les œuvres de Marina sont remontées en moi. Pas comme des souvenirs. Comme des alertes. Surtout quand des images télévisées ont montré les rues italiennes nettoyées à grands jets de désinfectant. Marina The Cleaner. Qui nettoyait le passé, qui nettoyait les charniers des guerres d’hier, qui nettoyait son corps en le lacérant, espérant le purifier. Un appel au propre, au pur – encore que je me méfiais de cette idée –, à l’hygiène de vie confondue avec l’hygiène des corps. Né des échanges mondialisés de biens et de personnes, le virus nous forçait à ériger des frontières partout. Frontières terrestres et aériennes, sans être bien sûrs de leur efficacité à nous protéger. Mais surtout frontières individuelles. Des sas entre nous. Qui aurait pu encore passer entre Marina et Ulay nus à l’entrée de leurs anciennes exhibitions des seventies ? En quelques semaines, nos corps étaient redevenus nos ultimes limites, nos barrières de chair et de peau. Pour prendre soin des autres, nous devions nous en tenir éloignés. La civilisation du sans contact nous transformait en îlots humains, chacun enfermé en soi, méfiant envers autrui. Et je revivais les mille expériences extrêmes de Marina dans ce qu’elles révélaient des limites entre la vie et la mort, de nos fragilités, de nos résistances, d’une résilience possible.
Eric Fottorino, Marina A (Gallimard, 2021).

An manchen Abenden oder auch vor dem Einschlafen ließ ich unsere vergangene Reise nach Florenz Revue passieren und hatte das Gefühl, dass wir solche Momente der Unbeschwertheit und Harmonie nie wieder erleben würden. Sie gehörten dem Gestern an, ohne Hoffnung auf ein Zurück. Das Gefühl des Verlustes belastete mich. Wir hatten das, was gar nicht normal war, wie eine normale Situation erlebt. Einer der letzten Momente in unserem früheren Leben, ohne dass uns jemand darauf aufmerksam gemacht hatte. Niemand, außer Marina A. hätte uns mit ihren enigmatischen, scheinbar nutzlosen oder absurden Performances einen Weg mit rätselhaften Umrissen gezeigt. Die Zerbrechlichkeit der Körper angesichts undurchschaubarer Gefahren, unsere Sterblichkeit als leichte Blätter, die am Faden des Lebens hingen, während man uns die bionische Ewigkeit versprach.
Jemand hatte gesagt – ich wusste seinen Namen nicht –, dass das Leben nur ein Traum sei und der Tod unser Weckruf. Manchmal träumte ich, dass ich ohne Maud und Lisa nach Florenz zurückkehre. Es war die gleiche Reise, die ich wieder durchlebte, mit dem Unterschied, dass ich mich allein in den Straßen der Altstadt wiederfand, allein am glitzernden Ufer des Arno, auf den Wegen durch die Boboli-Gärten, die ich atemlos hinunterlief, am Uffizien-Museum, vor dem Dom, wo seltsamerweise Priester in kleinen Zelten vereinzelten Gläubigen am Steuer ihrer Autos die Beichte abnahmen, alle maskiert und in sicherer Entfernung, in einem Handel von Sünden, von denen die einen die anderen befreiten. Genauer gesagt schien es eher, als würden die Gläubigen die Priester von ihren Fehlern befreien. Mein Herz raste ungewöhnlich. Ich rannte über die Plätze, über die Piazza della Signoria, die wir so oft gemeinsam überquert hatten, bevor wir uns erschöpft auf eine Lederbank im Café Rivoire setzten. Ich war ein Verrückter, der spürte, wie das Leben ihn verließ, als er die leeren Straßen zum Ponte Vecchio entlangschlenderte oder durch die Medici-Paläste mit ihren Gräbern, auf der Suche nach den Gefühlen von damals, als die Stadt von Lachen, Blitzlichtgewitter und Wasserspielen erfüllt war. Ich stieß die Türen verlassener Kirchen auf, rief vergeblich nach Maud und Lisa. Ich erlebte das, was Stendhal angeblich Florenz-Syndrom genannt hatte, eine heftige, schwindelerregende Blendung, eine Mischung aus Panik und Ekstase, das Zusammentreffen von Anmut und Finsternis, einen Schmerz, den die Kunst verursacht, wenn ihre unbegreifliche Schönheit einen überwältigt. In meinen Träumen, von denen mir beim Aufwachen nur noch Bruchstücke blieben, wie goldener Sand zwischen meinen Fingern, war ich mit Marina allein. Manchmal war sie es, die ich an einer Straßenecke erblickte, im Spiegelbild leerer Schaufenster, mit einer weißen Brautschleppe oder einer blutgetränkt roten. Manchmal war es nur ihr flüchtiger Schatten, den ich durch ein Lichtband gleiten sah.
Nach und nach wirkten diese dämmrigen Visionen wie ein fotografischer Entwickler auf Silbersalze. Die latenten Bilder, die ich von Marinas Erscheinungen in Florenz in mir bewahrt hatte, wurden immer deutlicher. Meine Vorahnung wurde fühlbar, fast tastbar, zum Greifen nah, in der Reichweite einer geschundenen Hand. Vor mir sah ich wieder die Ausdrücke kollektiver Angst gegenüber der sich mit einem Messer verletzenden Künstlerin. Dann ergriff mich das Offensichtliche an einem Morgen mit unruhigem Schlaf. Marinas Distanzierung von Ulay, wie auch von den unzähligen Besuchern des MoMA, kündigte nichts weniger an als die erste unserer Absperrgesten.
Im Krankenhaus hatten wir die Operationen auf bessere Zeiten verschoben. Nach einer dringenden Operation an einem kleinen Jungen mit akuter Hüftentzündung – eine Nichtpunktion hätte ihm ein bleibendes Hinken beschert – ließ ich mich auf unbestimmte Zeit beurlauben. Mein Team wusste, dass es mich jederzeit wieder anfordern konnte. Wir waren in die Epidemie eingetreten, die bereits als Pandemie bezeichnet wurde, manche mit einem großen „P“, das dem „A“ von Marina Abramovic trotzte. Als unsere Gesichter hinter nicht gerade karnevalistischen Masken verschwanden und die Gesundheitsvorschriften sich zu Performances entwickelten, die uns einen Monat zuvor noch verrückt erschienen wären – einen Meter Abstand zu anderen einhalten, in den Ellenbogen niesen, sich ständig die Hände waschen, nichts mehr im öffentlichen Raum anfassen, unter allen Umständen oder fast allen unsere Gesichter zur Hälfte unkenntlich machen –, stiegen Marinas Werke in mir auf. Nicht wie Erinnerungen. Sondern wie Warnhinweise. Vor allem, als dann Fernsehbilder zeigten, wie die italienischen Straßen mit großen Düsen von Desinfektionsmitteln gereinigt wurden. Marina The Cleaner. Die die Vergangenheit reinigte, die die Massengräber der Kriege von gestern reinigte, die ihren Körper reinigte, indem sie ihn aufschlitzte, in der Hoffnung, ihn zu purifizieren. Ein Aufruf zum Sauberen, zum Reinen – obwohl ich dieser Vorstellung misstraute –, zur Lebenshygiene, die mit Körperhygiene verwechselt wird. Das Virus, das durch den globalisierten Austausch von Waren und Personen entstanden war, zwang uns, überall Grenzen zu errichten. Land- und Luftgrenzen, wobei wir uns nicht sicher waren, ob sie uns wirklich schützen würden. Aber vor allem Grenzen der Individuen. Luftschleusen zwischen uns. Wer hätte noch zwischen Marina und Ulay nackt am Eingang zu ihren früheren Seventies-Ausstellungen hindurchgehen können? Innerhalb weniger Wochen waren unsere Körper wieder zu unseren ultimativen Grenzen geworden, zu unseren Barrieren aus Fleisch und Haut. Um uns um andere zu kümmern, mussten wir uns von ihnen fernhalten. Die Zivilisation der Kontaktlosigkeit verwandelte uns in menschliche Inseln, jeder in sich selbst eingeschlossen, misstrauisch gegenüber anderen. Und ich erlebte Marinas tausend extreme Erfahrungen erneut, in dem, was sie über die Grenzen zwischen Leben und Tod, über unsere Zerbrechlichkeit, unsere Widerstände und eine mögliche Resilienz enthüllten. 1
Kai Nonnenmacher
- „Kurz vor Weihnachten 2018 nimmt der Arzt Paul Gachet seine Frau und seine Tochter mit auf eine Entdeckungsreise durch Florenz. Während er darauf brennt, ihnen die Botticellis, die Reize der Altstadt und den Fluss Arno zu zeigen, wird ihr Aufenthalt durch das Auftauchen der serbischen Performerin Marina Abramovic gestört, die durch die Straßen der Stadt bis in die Säle des Palazzo Strozzi marschiert. Wer ist diese plötzlich allgegenwärtige Frau, die alle Bezugspunkte von Paul Gachet und den Seinen durcheinanderbringt, indem sie ihren eigenen Körper misshandelt, um zu einer tauben und versagenden Menschheit zu sprechen?
Paul Gachet, der als Chirurg und Orthopäde arbeitet, widerstrebt die Verstümmelung der Künstlerin. Er wird jedoch von ihrer Welt verzaubert, die sich nach und nach von einer scheinbar sinnlosen Gewalt entfernt und eine Suche nach Harmonie mit dem anderen ausdrückt, insbesondere mit ihrem Partner Ulay, den sie umarmt, bis er erstickt, bevor sie sein Haar mit dem seinen verknotet oder sein Herz dem Pfeil ihres Bogens aussetzt.
Zwei Jahre nach diesem Auftritt in Florenz stieß Paul Gachet zufällig auf ein altes Foto von Marina A und Ulay mit dem Titel L’impossible rapprochement („Die unmögliche Annäherung“). Es wurde 1983 in Bangkok aufgenommen und zeigt zwei Menschen, die sich gerne berühren würden, aber auf mysteriöse Weise daran gehindert werden und Abstand zueinander halten müssen. Als die weltweite Pandemie ausbrach, verstand Paul Gachet, dass die Manifestationen dieser Kunst eine Form der Warnung waren, deren Bedeutung er nun endlich in vollem Umfang begriff. Eine Aufforderung, den anderen zu schützen und unsere Gesellschaften auf den zwei kleinen Worten „nach euch“ neu zu gründen.“ Übers. der Verlagsankündigung.>>>