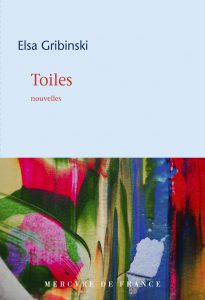Elle n’imaginait pas qu’on pût peindre avec du lait, elle voyait la blancheur du caillé, et depuis l’arrivée de l’hôte et le déballage des toiles à l’heure de midi, qu’on pût créer autant de couleurs avec ce qui en était dépourvu n’avait cessé de l’étonner.
Elsa Gribinski, Toiles, „À l’angle droit de son regard (Still life, Intérieur)“
Sie konnte sich nicht vorstellen, dass man mit Milch malen kann, sie sah das Weiß des Käsebruchs, und seit der Ankunft des Gastgebers und dem Auspacken der Leinwände zur Mittagszeit war sie immer wieder erstaunt, dass man mit etwas, das keine Farben hat, so viele Farben erzeugen kann.
Nach eigenem Bekunden schreibt Elsa Gribinski Kurzgeschichten, weil sie dicht und kurz schreibt. Dafür kam sie in die Auswahlliste für den Prix Goncourt de la nouvelle 2024. Die sechzehn Texte, die sie in Toiles: nouvelles (Mercure de France, 2024) gesammelt hat, sind besonders unter intermedialen Gesichtspunkten interessant: Jede Fiktion, oder jede „Leinwand“, thematisiert Malerei in einem ästhetischen Kontext, häufig im Alltagszusammenhang, „in der scheinbaren Banalität der Tage, ihrer Fremdheit, in Anekdoten und Träumen, dem Zufall, der Realität, in Liebesmomenten und Momenten des Abdriftens, auch in der Ironie, manchmal im Wahnsinn, in der Undurchsichtigkeit und der Transparenz“ (aus der Verlagsankündigung). Elsa Gribinski verwendet für jede Geschichte ein spezifisches künstlerisches und intermediales Verfahren, das mit der Thematik und Ästhetik der Erzählung verknüpft ist. Auffällig ist die Balance zwischen inneren und äußeren Räumen, zwischen täuschend echter Wahrnehmung und symbolischer Abstraktion.
Alltag und Arte povera
Ce matin, je suis allé chez le marchand de couleurs. Il restait un pauvre billet dans la poche intérieure de mon veston. J’ai aussi trouvé quelques pièces dans le fond d’un pantalon. Je suis passé devant la boucherie des Halles qui venait de se faire livrer, le camion réfrigéré stationnait encore, j’ai regardé les carcasses en vitrine. J’ai pensé à Rembrandt, et puis j’ai pensé à Bacon. Chez le marchand de couleurs, j’ai demandé du blanc, un grand tube d’acrylique de la marque la moins chère. En revenant, je suis repassé devant l’étal du boucher. J’ai eu envie de viande rouge. J’ai sorti de ma poche ce que j’avais pu sauvegarder en renonçant à la couleur. J’ai hésité. Finalement, je suis rentré.
Elsa Gribinski, Toiles, „Un doigt de bleu (Arte povera, Intérieur)“
Heute Morgen ging ich zum Farbenhändler. In der Innentasche meiner Jacke war noch ein armseliger Geldschein. Ich fand auch ein paar Münzen im Hosenboden. Ich ging an der Metzgerei in Les Halles vorbei, die gerade beliefert wurde, der Kühlwagen parkte noch, ich betrachtete die Kadaver im Schaufenster. Ich dachte an Rembrandt und dann an Bacon. Beim Farbenhändler fragte ich nach Weiß, einer großen Tube Acrylfarbe von der billigsten Marke. Auf dem Rückweg kam ich wieder an der Auslage des Metzgers vorbei. Ich hatte Lust auf rotes Fleisch. Ich zog aus meiner Tasche, was ich hatte retten können, indem ich auf Farbe verzichtet hatte. Ich zögerte. Schließlich ging ich nach Hause.
Die erste Geschichte „ARTY (Des images, extérieures, intérieures)“ spielt mit der Idee der Ähnlichkeit und der Wahrnehmung von Bildern. Im Mittelpunkt steht die Beobachtung einer Frau, die – in einem scheinbar banalen, aber intensiven Augenblick – in den Bus eingestiegen ist. Ihre Erscheinung, ihr Verhalten (wie das hastige Essen aus einem wiederverwendeten Plastiksack) und selbst kleine Details, wie die Erinnerung an vergangene Zeiten oder an andere Figuren, werden detailreich geschildert. Dabei wird nicht nur das äußere Geschehen abgebildet, sondern es öffnen sich auch innere Assoziationen des Erzählers, die sich in Erinnerungen und Reflexionen wiederfinden. Schon in der Eröffnung des Textes („Ich finde immer wieder Ähnlichkeiten – ein Schubladenspiel.“ – „Je ne cesse de trouver des ressemblances – un jeu de tiroirs.“) wird expliziert, dass der Erzähler eine Vielzahl von Bildern verknüpft. Es entsteht ein Spiel mit Assoziationen: Die Außenwelt (die reale Szene im Bus, das urbane Treiben) mischt sich mit inneren Bildern, Erinnerungen und subjektiven Eindrücken. Dieser Wechsel zwischen dem Sichtbaren und dem Imaginären prägt den Erzählverlauf.

In der Erzählung „Blues’omatic“ von Gribinski steht eine alltägliche Szene im Mittelpunkt: Eine Wäscherin diskutiert mit einem Mann über die Flecken auf seinen Kleidern. Was zunächst wie eine simple Interaktion über Farben und Sauberkeit erscheint, entfaltet sich zu einem diskursiven Spiel über Wahrnehmung, Sprache und Kunst. Der Dialog ist von Anspielungen auf die Physik, Malerei, Film und Farbtheorie durchzogen. Die Beziehung zwischen den beiden Figuren bleibt ambivalent – zwischen Bewunderung, Ironie und latenter Anspannung. Die Erzählung spielt mit der Wahrnehmung von Farben. Der Mann verweist auf Vermeers Gemälde La Laitière, vergleicht die Kopfhaltung der Wäscherin mit der des Milchmädchens, und stellt eine Verbindung zwischen ihrem Beruf und der Farbe Weiß her. Dabei wird Weiß nicht nur als Farbe, sondern als Konzept betrachtet – es steht für Reinheit, aber auch für eine Projektionsfläche, die Bedeutungen aufnimmt. Neben Vermeer werden Werke von Jean-Luc Godard als Referenz herangezogen. Die weibliche Figur wirkt wie eine Protagonistin aus einem Nouvelle-Vague-Film, deren Mimik und Gestik in einem filmischen Kontext gelesen werden kann. Dies verstärkt die Idee, dass sich das Visuelle und das Sprachliche in der Erzählung überlagern. Gribinski nutzt ein sprachliches Spiel mit Farben und deren Benennung. Die Dialoge sind knapp, pointiert und oft von ironischen Untertönen geprägt. Es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Banalen (Fleckenentfernung) und dem Künstlerischen (Kunstbetrachtung, Farbtheorie), und so verbindet „Blues’omatic“ Alltagssprache mit kunsttheoretischen Reflexionen.
Die Erzählung „Un doigt de bleu – (Arte povera, Intérieur)“ spielt in einem Innenraum, der eine intime, fast meditative Atmosphäre vermittelt. Die Szenerie ist geprägt von einer ruhigen, beinahe stillen Beobachtung eines minimalen, aber bedeutungsvollen Details: eines kleinen, blauen Flecks – „un doigt de bleu“ (wörtlich: „ein Fingerbreit Blau“). Dieser Farbklecks, der auf einem Objekt, einer Wand oder der Haut erscheint, wird zum poetischen Ausgangspunkt einer Reflexion über Wahrnehmung, Materialität und ästhetische Erfahrung. Der Protagonist oder die Protagonistin fixiert sich auf das kleine Detail der blauen Spur. In einer scheinbar unbedeutenden Kleinigkeit entdeckt die Figur eine ganze Welt an Möglichkeiten, Assoziationen und Bedeutungen. Der blaue Farbton kann an den Himmel, das Meer oder Pigmente aus der Malerei erinnern – oder schlicht als ein zufälliger Fleck in einer alltäglichen Szene stehen. Im Einklang mit dem Prinzip der Arte Povera richtet die Erzählung ihre Aufmerksamkeit auf das Einfache, das Zufällige, das, was oft übersehen wird. Anstatt große, kunstvoll inszenierte Szenerien zu beschreiben, konzentriert sich der Text auf das Fragmentarische, das Rohmaterialhafte – einen kleinen Hauch von Farbe, der für sich genommen fast trivial erscheint, aber in seiner Isolierung eine starke visuelle und emotionale Wirkung entfaltet. Neben der Farbe selbst spielt auch die Textur eine Rolle. Die Erzählung beschreibt die Beschaffenheit des Materials, auf dem sich das Blau befindet: Ist es rau oder glatt? Ist es Teil eines Kunstwerks oder bloß eine zufällige Spur, die durch eine Berührung entstanden ist? Diese sinnliche, fast taktile Dimension verstärkt die Konzentration auf das Physische, auf die unmittelbare Gegenwart des Moments.
Arte Povera (italienisch für „arme Kunst“) ist eine Kunstrichtung aus den 1960er-Jahren, die einfache, rohe, oft alltägliche Materialien in den Mittelpunkt stellte. Künstler wie Michelangelo Pistoletto oder Jannis Kounellis arbeiteten mit Naturstoffen, Industrieabfällen oder Fundstücken, um die Grenzen zwischen Kunst und Leben aufzuheben. Die Erzählung folgt diesem Prinzip, indem sie ein unscheinbares Detail – einen blauen Fleck – ins Zentrum rückt. Sie verzichtet auf große narrative Inszenierungen und konzentriert sich auf das Kleine, das Zufällige, das oft Übersehene. Dadurch entsteht eine Poetik des Minimalismus, die mit reduzierten Mitteln eine große Wirkung erzielt. Im Geiste der Arte Povera stellt die Erzählung die Frage: Was ist Kunst? Muss ein Objekt bewusst als Kunstwerk geschaffen werden, oder reicht es, dass der Betrachter es als solches wahrnimmt? Die Fixierung auf die blaue Spur macht aus ihr fast automatisch ein Bild, eine Miniatur, eine abstrakte Komposition, die sich mit den Prinzipien der modernen Kunst in Verbindung bringen lässt. Die Erzählung zeigt, dass Schönheit und Bedeutung nicht in großen Gesten oder in spektakulären Kunstwerken liegen müssen, sondern in der Fähigkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Der Blick für das scheinbar Nebensächliche wird zu einem künstlerischen Akt, der das Alltägliche auf eine poetische Ebene hebt.
„Un doigt de bleu – (Arte Povera, Intérieur)“ ist eine Erzählung, die durch ihre Konzentration auf ein minimales, zufälliges Detail eine meditative Tiefe erreicht. Inhaltlich beschreibt der Text die Wahrnehmung eines kleinen blauen Farbspuren-Fleckens und macht ihn zum Zentrum einer kontemplativen Erfahrung. Der Blick auf das scheinbar Belanglose wird zu einem Moment der künstlerischen Erkenntnis. Intermedial verbindet die Erzählung sich mit der Ästhetik der Arte Povera: Durch die Fokussierung auf Einfachheit, Materialität und das rohe, zufällig Erscheinende gelingt es dem Text, eine Kunstform nachzubilden, die sich der herkömmlichen Definition von Kunst widersetzt. Der Text fordert den Leser auf, das Kleine, das Übersehene und das Alltägliche mit neuen Augen zu betrachten. Indem er ein einziges Detail – ein „Fingerbreit Blau“ – zum Ausgangspunkt einer Reflexion über Wahrnehmung, Kunst und Materialität macht, lädt er dazu ein, sich der Schönheit des Unscheinbaren bewusst zu werden. Zusammenfassend ist „Un doigt de bleu – (Arte Povera, Intérieur)“ eine Erzählung, die die Prinzipien der Arte Povera in literarischer Form umsetzt. Sie zeigt, dass sich Kunst nicht nur in Museen oder auf Leinwänden findet, sondern auch in den zufälligen Spuren des Alltags – wenn man nur genau genug hinsieht.
Toiles: Katalog der Intermedialität
Arty (Des images, extérieures, intérieures) – bildhafte Überlagerungen, die zwischen äußerer und innerer Wahrnehmung wechseln. Die Autorin beschreibt eine alltägliche Szene, die eine Reihe visueller und symbolischer Entsprechungen hervorruft – ein wahres Spiel von Assoziationen.
Le grand pan de mur noir (Anamorphose, Extérieur) – Anamorphosen spielen mit Perspektive und Verzerrung, um eine veränderte Wahrnehmung zu erzeugen. Die anamorphe Erzählweise dieses Textes zeigt sich insbesondere in der Art und Weise, wie Wahrnehmung, Reflexion und Projektion ineinanderfließen und sich verzerren.
Autoportrait (Conversation piece, Intérieur) – der „conversation piece“-Stil verweist auf Szenen, die ein erzählerisches Element in der Kunst betonen, ein Gruppenporträt, das Personen in Interaktion zeigt. Die Geschichte nutzt dieses Format, um über das Selbstbild und die Reflexion des Künstlers nachzudenken. Die Intermedialität liegt in der sprachlichen Nachahmung eines Bildes: Der Dialog wird selbst zum Porträt, indem er die Figuren in Szene setzt.
Tain d’automne (A tempera, Extérieur) – die Temperamalerei betont eine leuchtende Farbigkeit und eine detailreiche Oberfläche. Die Geschichte verwendet dieses Verfahren symbolisch für Erinnerungen, die trotz des Vergehens der Zeit lebendig bleiben. Der Regen, der das Bild verwischt, steht im Kontrast zur Beständigkeit der Temperafarben – ein intermedialer Dialog zwischen Malerei und Narration.
Renaissance (Annonciation, Extérieur) – Anspielung auf das klassische Verkündigungs-Motiv, das zwischen göttlicher und weltlicher Realität vermittelt. Die Geschichte greift das Motiv der Verkündigung auf, aber in einer modernen, ironischen Weise. Sie stellt die göttliche Inspiration der Renaissance-Meister infrage und überträgt sie auf eine alltägliche Erfahrung. Die Intermedialität entsteht durch die Auseinandersetzung mit religiöser Kunst und deren Einfluss auf persönliche Lebensentscheidungen.
Jouy (Trompe-l’œil, Extérieur) – täuschend echte Darstellungen, die mit der Grenze zwischen Realität und Illusion spielen. Die „Toile de Jouy“ ist ein Stoff mit narrativen, oft ländlichen Szenen. Die Geschichte spielt mit der Idee, dass ein Bild sowohl eine Illusion als auch eine Erzählung sein kann. Die Hauptfigur sucht nach einem Stoffmuster, das eine Geschichte erzählen soll – und erkennt dabei, dass ihre eigene Wahrnehmung bereits ein Trompe-l’œil ist.
À l’angle droit de son regard (Still life, Intérieur) – ein Stillleben, das eine symbolische Bedeutung für Vergänglichkeit oder Kontemplation trägt. Es zeigt scheinbar leblose Objekte, oft mit Vanitas-Symbolik. Die Erzählung verwandelt den Blick der Protagonistin in ein Stillleben: Die Reste einer Mahlzeit, das Licht auf einer Orange – alles wird zu einem Gemälde in der Sprache.
Macula (Fresque, Extérieur) – die Freskotechnik verbindet Bild mit Architektur und verweist auf Dauerhaftigkeit. Das Bild ist untrennbar mit der Wand verbunden – es wird Teil der Architektur. Die Geschichte nutzt dieses Prinzip, indem sie eine Szene entwirft, die sich nicht von ihrer Umgebung lösen lässt. Es geht um die Verbindung von Raum, Erinnerung und Narration, wobei die Erzählung selbst freskenartig fest in der Außenwelt verankert ist.
Masterpiece (Work in progress, Intérieur) – das Konzept des „work in progress“ hebt die Unabgeschlossenheit eines Kunstwerks hervor. Die Geschichte reflektiert über kreative Prozesse und darüber, wie Werke im Entstehen begriffen sind. Sie stellt damit auch die eigene Narration infrage: Ist eine Geschichte jemals wirklich „fertig“?
Un doigt de bleu (Arte povera, Intérieur) – Arte povera betont die Materialität und Einfachheit von Kunst, sie nutzt einfache Materialien und hinterfragt den Kunstbegriff. Die Geschichte wendet dieses Prinzip auf das Leben der Figuren an: Sie zeigen, wie Kunst aus dem Alltäglichen entsteht. Es geht um die Poesie des Gewöhnlichen und die Möglichkeit, mit wenig Mitteln eine neue Perspektive auf die Welt zu gewinnen.
Autour, ou à côté (Vanité, Intérieur) – Vanitas-Symbolik verweist auf Vergänglichkeit und den Kreislauf des Lebens. Die Erzählung greift dieses Prinzip auf, indem sie über das Vergehen der Zeit, Erinnerungen und die Illusion der Dauerhaftigkeit reflektiert. Sprache wird hier selbst zur Vanitas-Darstellung: Sie bewahrt und zerstört zugleich.
Un cheval courait (Paysage, Intérieur) – Landschaftsdarstellungen, die eine poetische Raumwirkung erzeugen. Landschaftsmalerei vermittelt Raum und Atmosphäre. Die Geschichte nutzt dieses Prinzip, um eine psychologische Landschaft zu erschaffen: Die Innenwelt der Figur spiegelt sich in der äußeren Umgebung wider. Die Intermedialität zeigt sich in der Verschmelzung von Naturbeschreibung und emotionalem Zustand.
Bestiaire (Ombres chinoises, Extérieur) – Schattenspiel als Mittel der Abstraktion und Narration. Schattenspiele reduzieren die Welt auf Umrisse und Bewegung. Die Geschichte spielt mit diesem Prinzip, indem sie Figuren und Ereignisse nur in Schattenrissen zeigt. Dadurch entsteht eine poetische, fragmentierte Erzählweise, die die Abstraktion der Scherenschnittkunst in Sprache übersetzt.
Portrait des lents demains (Perspective, Intérieur) – perspektivische Konstruktionen zur Manipulation der Raumwirkung. Die Perspektive in der Malerei verändert, wie wir einen Raum wahrnehmen. Die Erzählung nutzt dieses Konzept, indem sie die Sichtweise der Figuren verschiebt und den Leser herausfordert, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Das Spiel mit Nähe und Distanz ist ein zentrales intermediales Element.
Blues’omatic (Scène de genre, Extérieur) – szenische Darstellungen mit Alltagsmotiven, die soziale Narrative aufgreifen. Eine „Scène de genre“ zeigt alltägliche Szenen mit sozialer Aussage. Die Geschichte übernimmt dieses Prinzip und setzt es in ein urbanes Setting. Wie in einem Gemälde von Vermeer oder Hopper wird der Moment eingefroren, wodurch das Alltägliche eine tiefere Bedeutung erhält.
Clôture – On n’y voit rien (Des images, intérieures, extérieures) – offene Reflexion über Bilder und Wahrnehmung, sowohl in der Außen- als auch Innenwelt. Die letzte Geschichte reflektiert über die Unsichtbarkeit von Bildern und das Sehen an sich. Sie hinterfragt die Grenzen zwischen innerer Vorstellung und äußerer Realität. Die Intermedialität besteht darin, dass das Fehlen von Bildern selbst zum künstlerischen Prinzip wird – eine Art literarischer „Negativraum“.
Nur einige der Erzählungen erwähnen konkrete Maler oder Gemälde, häufig sind es bloße Anspielungen, wie das schwarze Quadrat in „Le grand pan de mur noir“, die langen, vogelhalsartigen Hälse wie bei Modigliani in „Autoportrait“, eine ikonographische Szene wie die Verkündigung in „Renaissance“, in „Jouy“ Erinnerungen an Stoffszenen bei Fragonard, aber auch kubistische Formen bei Picasso, Verweise auf Van Gogh und Rimbaud in „Masterpiece“, auf die Darstellung von Fleisch bei Rembrandt und Francis Bacon in „Un doigt de bleu“, auf Goya und das Schattentheater in „Bestiaire“. Malerei, so leitet Gribinski aus dem Mittelalter her, „Malerei war also Sprache“:
La peinture, dans l’histoire, avait d’abord été une description, une évocation imagée faite à l’aide de mots. C’était ce que le terme signifiait dans un bestiaire du tout début du XIIe siècle, c’était ce qu’on y lisait. La représentation graphique, colorée, venait peu après dans l’ordre de la langue. Il était là aussi question de bêtes, ou plutôt de leurs images, listées d’azur, ainsi désignées pour la première fois par le mot « peinture ». À l’évidence, les serpents s’y mordaient la queue.
La peinture, c’était donc du langage… Et le langage, outre qu’il créait des images, était nécessairement coloré : car c’était cela qui restait dans le mot désignant dorénavant une représentation graphique, l’image ne se formait là que par la couleur. Et il y avait enfin ceci de non moins essentiel, de non moins remarquable, que ce qui était représenté ne pouvait qu’appartenir au monde visible. Il était vrai que le monde médiéval voyait l’invisible et ce qu’aujourd’hui on ne voit plus : ce qui est gravé dans l’esprit, fixé dans le cœur – c’est aussi ce que le mot « peinture » avait d’emblée désigné. La peinture était avant tout une représentation mentale, ou bien sentimentale.
Précisément, ce que signalait le triangle ainsi recouvert restait invisible.
Le soir tombait, l’eau montait dans l’air, il fallut rentrer. La nuit fut pleine, des brouillards froids et chauds voilaient de plates peintures, un lavis rupestre inventait des aérographes crachant des portraits dramatiques aux maquillages monochromes, de fausses pattes de lièvres y encadraient des sourires d’opiats, Gwynplaine, la rétine marquée de jaune…
On y voyait aussi des peintures d’histoire en médaillon, l’effigie d’un paysage en ronde bosse, de grises enluminures, la facture moderne d’une géométrie en couleur, une géographie, peut-être, une toile instable, ouverte à tous les genres et les altérant, ignorante des règles. Une lune nette dessinait des visages infidèles encombrés de nerfs optiques.
La nuit, capable d’imaginer, son ciel et le temps très noir passant à guetter sous la surface ce qui ne se montre pas.
Gribinski, Toiles, „Macula (Fresque, Extérieur)“.
In der Geschichte war die Malerei zunächst eine Beschreibung, eine bildhafte Beschwörung, die mithilfe von Worten erfolgte. Das war es, was der Begriff in einem Bestiarium aus dem frühen zwölften Jahrhundert bedeutete, das war es, was man dort las. Die bunte, grafische Darstellung folgte kurz darauf in der Reihenfolge der Sprache. Auch hier war von Tieren die Rede, oder vielmehr von ihren Bildern, die in Azur aufgelistet waren und somit zum ersten Mal mit dem Wort „Malerei“ bezeichnet wurden. Es war offensichtlich, dass sich die Schlangen in den Schwanz bissen.
Malerei war also Sprache … Und Sprache war, abgesehen davon, dass sie Bilder schuf, notwendigerweise farbig: Denn das war es, was in dem Wort, das von nun an eine grafische Darstellung bezeichnete, übrig blieb, das Bild entstand dort nur durch Farbe. Und schließlich war da noch die nicht weniger wesentliche, nicht weniger bemerkenswerte Tatsache, dass das, was abgebildet wurde, nur der sichtbaren Welt angehören konnte. Es war wahr, dass die mittelalterliche Welt das Unsichtbare sah und das, was man heute nicht mehr sieht: das, was sich in den Geist einbrennt, im Herzen festhält – auch das hatte das Wort „Malerei“ von Anfang an bezeichnet. Malerei war in erster Linie eine mentale oder auch sentimentale Darstellung.
Was genau das übermalte Dreieck anzeigte, blieb unsichtbar.
Es wurde Abend, das Wasser stieg in die Luft auf, und wir mussten nach Hause gehen. Die Nacht war voll, kalte und warme Nebel verschleierten flache Gemälde, eine Höhlenmalerei erfand Airbrushes, die dramatische Porträts mit monochromer Schminke ausspuckten, falsche Hasenfüße umrahmten das Lächeln von Opiaten, Gwynplaine, dessen Netzhaut gelb markiert war …
Man sah auch Historiengemälde in Medaillons, das Bildnis einer Landschaft in rundem Buckel, graue Buchmalerei, die moderne Faktur einer Geometrie in Farbe, eine Geographie vielleicht, eine instabile Leinwand, die allen Genres offensteht und sie verändert, ohne Regeln zu kennen. Ein klarer Mond zeichnete untreue Gesichter, belastet mit Sehnerven.
Die Nacht, in der Lage, sich etwas vorzustellen, ihr Himmel und das tiefschwarze Wetter, unter der Oberfläche auf das lauern, was sich nicht zeigte.
Toiles stellt eine enge Verbindung zwischen literarischer Sprache und bildender Kunst her, indem sie verschiedene Malstile, Kunstkonzepte und spezifische Werke als Bezugspunkte für ihre Erzählungen nutzt.
Der Text „À l’angle droit de son regard“ beschreibt mit feiner Detailgenauigkeit die Anordnung von Objekten: Eine makellose Tischdecke, die Reste einer Mahlzeit, Gläser, Teller und vielleicht eine Orange oder andere Früchte. Diese Objekte erscheinen in ihrer Stille und scheinbaren Unveränderlichkeit fast wie eingefrorene Momente des Alltags. Der Zusatz „Still life, Intérieur“ verweist klar auf das Genre des Stilllebens, das in der bildenden Kunst für die Darstellung arrangierter, alltäglicher Objekte steht. Die Erzählung nutzt eine präzise, bildhafte Sprache, um diese Anordnung in Worte zu fassen. Die detaillierte Beschreibung der Gegenstände – ihrer Form, Farbe und Lichtreflexion – erzeugt bei der Leserschaft ein visuelles Abbild, das an ein Gemälde erinnert. Während die Objekte selbst in ihrer Stille verharren, wird der Blick der Protagonistin als lebendiger, beweglicher Teil der Szene inszeniert. Der „rechte Winkel“ ihres Blicks deutet darauf hin, dass der individuelle Sehvorgang nicht nur passiv, sondern aktiv und selektiv ist. Dieser dynamische, subjektive Blick kontrastiert mit der statischen Ordnung der Gegenstände – so wie in einem Stillleben, in dem das Arrangement zwar festgelegt, aber dennoch von der Betrachtungsperspektive abhängig ist. Die arrangierten Gegenstände – sei es ein verblasstes Obst, ein fast perfekter Teller oder das Zusammenspiel von Licht und Schatten auf der Tischdecke – werden nicht bloß als Gebrauchsgegenstände dargestellt. Vielmehr erhalten sie eine symbolische Dimension, die an die Vergänglichkeit und gleichzeitig an die Schönheit des Alltäglichen erinnert. Die Erzählung „malt“ mit Worten, indem sie einzelne Details in den Vordergrund rückt und so eine Szene konstruiert, die in ihrer Ästhetik an ein Gemälde erinnert. Jede Beschreibung fungiert wie ein Pinselstrich, der zur Gesamtkomposition beiträgt und dem Leser erlaubt, sich das Arrangement als visuelles Objekt vorzustellen.
J’ai continué de parcourir l’encombrement, l’agglomération des strates palimpsestes, les bocaux, les conserves aux couvercles plus tranchants que leurs bords, rabattus de force, leur découpe inachevée. On y pouvait savoir ce dont il se nourrissait, s’était nourri, la veille, la semaine précédente, le mois passé, et peut-être neuf ans auparavant. Ce qu’il avait bu, aussi. Side up – Tear off to op.
De sous l’angle droit du ciel dépassait une publicité pour un guide gratuit de police d’assurance. La réclame titrait : « Tomorrow’s today ». Je m’oubliais un instant à traduire. L’anglais est facétieux. All purpose… Je repensais aux caractères transferts du Letraset incomplet.
Dans le fond de la pièce, des châssis volontairement stockés en appui contre les fenêtres déjà voilées les obstruaient, la lumière naturelle ne parvenait plus que du puits de jour. Je me déplaçais le moins possible, d’un pas ou deux, les yeux précautionneusement rivés au sol et demeurais alors sur l’îlot minuscule que mes pieds, par chance, avaient trouvé, m’efforçant de conserver ma position aussi longtemps que possible, ne bougeant plus que le regard, puis la tête, et pivotant du buste au besoin pour le suivre de loin, jusqu’à ne plus pouvoir faire autrement que de me déplacer de nouveau, car il m’appelait d’un geste ou de quelques mots, « you see this ? », m’invitant à examiner avec lui la nuance précise d’une huile orange ou le rose craquelé d’un rouleau qui n’aurait plus d’usage.
Les grands châssis des cadres à hauteur d’homme reposaient aussi bien sur les pans maculés des murs – de hautes fenêtres, blanches et opaques, privées de crémone. Les toiles vierges tournaient le dos.
Je me suis demandé quel pouvait être le sujet du désordre. Comme on s’interroge sur le sujet d’une image. Et peut-être était-ce l’incident lui-même, le hasard de ce qui se trouve là, juste là, et non tout à côté. Une composition qui gardait trace de son processus et montrait cette trace vive – son sujet même.
Ainsi, le désordre rendait compte, chaque objet, chaque parcelle de matière, chaque chose et l’ensemble jusqu’aux déchirures des étiquettes sur les emballages exposaient l’instant accidenté, incessant, un temps suspendu désormais dans l’état présent de l’accumulation, exhibé dans les inclinaisons des faisceaux buissonnants ou des grands cartons en travers, dans l’équilibre précaire des boîtes renversées, dans l’instabilité feuilletée des piles de journaux et de magazines, de coupures et de papiers, dans le flux figé des constellations et des tracés au mur. La vie s’étalait là, létale. Et, bien plus que par la photographie, c’était comme dans ses tableaux : un mouvement immobile, l’évidence d’une présence, le temps condensé, le suspens dans le geste de la représentation.
Je considérais ce lieu, en apparence pourtant si dissemblable de l’ordre de ses toiles. Je songeais à ce qu’il avait dit de la difficulté de peindre : que la toile n’était pas vierge, pas blanche, mais bien au contraire encombrée de tout ce qui l’avait précédée et l’entourait encore. Comme nous-mêmes, préoccupée.
Mon regard s’est arrêté sur une boîte de haricots blancs. J’ai pensé : Le vrai sujet de nos vies n’est pas ce vers quoi l’on tend mais ce qui nous fait tendre. C’était juste, mais c’était un peu plat. La boîte avait été ouverte à l’envers. Je déchiffrais difficilement l’anglais la tête en bas. Tant de conserves, de choses conservées. Le vrai sujet, c’est une apparition.
J’ai contemplé la porte, le rose, l’orange, les ronds des tampons dont l’excès de peinture avait été déposé là. La seconde bottine traînait à ma droite.
Il m’a souri de nouveau, comme pour s’excuser du désordre. Il est resté un moment silencieux, puis il a dit en français, avec cet accent qui ne marque pas l’« r » : « C’est un terrible désordre. Mais enfin, il vaut mieux qu’un décor. Vous restez dîner ? »
Elsa Gribinski, Toiles, „Masterpiece (Work in progress, Intérieur)“
Ich ging weiter durch die Unordnung, die Anhäufung von Palimpsestschichten, die Gläser, die Konserven mit den Deckeln, die schärfer als ihre Ränder waren, mit Gewalt umgeklappt, ihr Schnitt unvollendet. Hier konnte man erfahren, wovon er sich ernährte, ernährt hatte, am Vortag, in der Woche zuvor, im letzten Monat und vielleicht vor neun Jahren. Was er getrunken hatte, ebenfalls. Side up – Tear off to op.
Aus dem rechten Winkel des Himmels ragte eine Werbung für einen kostenlosen Leitfaden für Versicherungspolicen. Die Schlagzeile lautete: „Tomorrow’s today“ (Morgen ist heute). Ich vergaß für einen Moment zu übersetzen. Das Englische ist schelmisch. All purpose … Ich dachte an die übertragenen Schriftzeichen des unvollständigen Letraset.
Im hinteren Teil des Raumes versperrten absichtlich gelagerte Fensterrahmen, die gegen die bereits verhangenen Fenster gelehnt waren, die Fenster, sodass das Tageslicht nur noch aus dem Oberlicht kam. Ich bewegte mich so wenig wie möglich, ein oder zwei Schritte, hielt meine Augen vorsichtig auf den Boden gerichtet und blieb dann auf der winzigen Insel, die meine Füße glücklicherweise gefunden hatten, und bemühte mich, meine Position so lange wie möglich zu halten, bewegte nur noch meinen Blick, dann meinen Kopf und drehte meinen Oberkörper, wenn nötig, um ihm aus der Ferne zu folgen, bis ich nicht mehr anders konnte, als mich wieder zu bewegen, denn er rief mich mit einer Geste oder einigen Worten, „you see this?“, und lud mich ein, mit ihm die genaue Nuance eines orangefarbenen Öls oder das rissige Rosa einer Rolle, die nicht mehr gebraucht werden würde, zu untersuchen.
Die großen Rahmen der mannshohen Keilrahmen lagen ebenso gut auf den verschmierten Seiten der Wände – hohe, weiße, undurchsichtige Fenster, die keine Treibriegel besaßen. Die leeren Leinwände standen mit dem Rücken zu mir.
Ich fragte mich, was das Thema der Unordnung sein könnte. So wie man sich nach dem Thema eines Bildes fragt. Und vielleicht war es der Vorfall selbst, der Zufall dessen, was da ist, genau da und nicht ganz daneben. Eine Komposition, die ihren Prozess festhielt und diese lebendige Spur – ihr eigentliches Thema – zeigte.
So berichtete die Unordnung, jeder Gegenstand, jedes Stückchen Materie, jedes Ding und alles zusammen bis hin zu den Rissen in den Etiketten auf den Verpackungen stellten den unfallbedingten, unaufhörlichen Augenblick aus, eine Zeit, die nun im gegenwärtigen Zustand der Anhäufung aufgehoben war, zur Schau gestellt in den Neigungen der buschigen Bündel oder der großen, quergestellten Kartons, im prekären Gleichgewicht der umgestürzten Schachteln, in der blattförmigen Instabilität der Stapel von Zeitungen und Zeitschriften, Ausschnitten und Papieren, im eingefrorenen Fluss der Konstellationen und der Pausen an der Wand. Das Leben breitete sich dort letal aus. Und viel mehr als durch die Fotografie war es wie in seinen Bildern: eine unbewegte Bewegung, die Evidenz einer Präsenz, die verdichtete Zeit, die Spannung in der Geste der Darstellung.
Ich betrachtete diesen Ort, der scheinbar doch so unähnlich der Ordnung seiner Gemälde war. Ich dachte daran, was er über die Schwierigkeit des Malens gesagt hatte: dass die Leinwand nicht jungfräulich, nicht weiß, sondern im Gegenteil mit allem belastet ist, was ihr vorausgegangen war und sie noch immer umgibt. Wie wir selbst, beschäftigt.
Mein Blick blieb an einer Dose mit weißen Bohnen hängen. Ich dachte: Das wahre Thema unseres Lebens ist nicht das, worauf wir hinarbeiten, sondern das, was uns dazu bringt, uns anzuspannen. Das war richtig, aber es war ein bisschen flach. Die Schachtel war verkehrt herum geöffnet worden. Mit dem Kopf nach unten entzifferte ich mühsam das Englisch. So viele Konserven, so viele konservierte Dinge. Das eigentliche Thema war eine Erscheinung.
Ich betrachtete die Tür, das Rosa, das Orange, die runden Stempel, deren überschüssige Farbe dort abgelegt worden war. Der zweite Stiefel lag zu meiner Rechten.
Er lächelte mich wieder an, als wollte er sich für die Unordnung entschuldigen. Er schwieg eine Weile und sagte dann auf Französisch, mit diesem Akzent, der das „r“ nicht markiert: „C’est un terrible désordre. Aber schließlich ist es besser als eine Kulisse. Bleiben Sie zum Essen?“
Der Titel „Masterpiece“ spielt zunächst auf das Ideal eines vollendeten Meisterwerks an, wird aber unmittelbar relativiert durch den Zusatz „Work in progress“. Diese Spannung – zwischen dem Streben nach Vollendung und dem Bewusstsein, dass wahre Kreativität niemals in einem statischen Endprodukt mündet – bildet den Kern der Erzählung. Der Protagonist sinniert über den fortwährenden Zustand des Werdens. Es werden Gedanken darüber angestellt, wie sich ein Werk im Fluss befindet, wie es immer wieder verändert, korrigiert und erweitert wird. Dabei stehen Fragen in den Mittelpunkt wie: Was bedeutet es, etwas zu schaffen? Kann ein Kunstwerk je wirklich „fertig“ sein? Die Erzählung betont, dass die Zeit als Element des Schaffensprozesses untrennbar mit der Entstehung eines Kunstwerks verbunden ist. Jede Sekunde, jeder Augenblick der Inspiration, aber auch der Zweifel und der Überarbeitung wird als Teil des kreativen Weges gewürdigt. Dies führt zu einer fast meditativen Stimmung, in der das fortwährende Werden – das stete Pendeln zwischen Idee und Ausdruck – im Vordergrund steht. Die Erzählung „Masterpiece“ spielt in einem privaten, abgeschlossenen Innenraum, der als Atelier oder Rückzugsort interpretiert werden kann. Hier befindet sich der Protagonist – oder eine erzählende Figur –, der sich intensiv mit seinem eigenen kreativen Schaffensprozess auseinandersetzt. Der Raum ist durch eine gewisse Unordnung, aber auch durch klare Spuren des künstlerischen Arbeitens geprägt: Überreste von Skizzen, halbvollendete Kompositionen, verstreute Werkzeuge und Farbkleckse deuten darauf hin, dass hier ein intensiver Prozess des kreativen Werdens stattfindet. Die Sprache des Textes ist dabei bewusst malerisch und dynamisch. Beschreibungen von fließenden Übergängen, sich verändernden Details und dem Zusammenspiel von Licht und Schatten in der eigenen Vorstellung wirken wie Pinselstriche auf einer Leinwand. So wird der innere Monolog des Protagonisten zu einer Art lebendiger Skizze, die den unvollständigen Zustand eines „Meisterwerks“ – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn – illustriert.
Die Erzählung „Macula“ spielt in einem äußeren, öffentlichen Raum, der von der Präsenz eines monumentalen, fast architektonisch wirkenden Wandabschnitts dominiert wird. Diese Wand wird als ein lebendiges „Fresko“ inszeniert – ein großes, in die Bausubstanz integriertes Bild, das von den Spuren der Zeit und der Natur gezeichnet ist. Der Begriff „Macula“ (lateinisch für „Fleck“ oder „Makel“) verweist zugleich auf die Unvollkommenheiten, die sich im Laufe der Zeit auf der Oberfläche ansammeln, und auf das unvermeidliche Zusammenspiel von Schönheit und Vergänglichkeit. Der Protagonist richtet seinen Blick auf diese Wand, deren Oberfläche von Wettereinflüssen, Alterungsprozessen und wiederholten Übermalungen geprägt ist. Die Beschreibung der Wand offenbart Schichten – alte Putzschichten, verblasste Farben und neuere Anstriche –, die miteinander in Dialog treten. Die unregelmäßigen Flecken, Risse und Farbschattierungen wirken wie eingebrannte Erinnerungen. Die Wand erzählt, ohne zu sprechen, von vergangenen Momenten, von gelebter Geschichte und den Spuren menschlichen Schaffens. Diese visuelle Erinnerung ruft in der Betrachtung eine gewisse Melancholie hervor, die den steten Wandel der Zeit symbolisiert. Da die Erzählung explizit im Außenraum („Extérieur“) verortet ist, wird die Wand nicht als rein isoliertes Kunstobjekt, sondern als integraler Bestandteil des urbanen Lebensraums inszeniert. Der öffentliche Charakter dieses Ortes verleiht der Szene eine zusätzliche Dimension: Die Wand ist Zeugin des ständigen Kommens und Gehens, der wechselnden Lichtverhältnisse und des urbanen Alltags. Inhaltlich zeigt die Erzählung, wie sich Geschichte und Erinnerung in der physischen Beschaffenheit eines Bauwerks manifestieren. Die Wand, deren Oberfläche von unregelmäßigen Flecken und Rissen durchzogen ist, erzählt still von vergangenen Ereignissen und den Spuren menschlichen Wirkens. Intermedial wird die Erzählung zu einem literarischen Fresko: Die Sprache agiert wie Farbe auf Putz, sie schichtet Eindrücke, malt Details und schafft so ein visuelles Bild, das zugleich starr und wandelbar ist. Die Technik des Freskos wird zum Symbol für das Ineinandergreifen von Kunst, Architektur und Zeit – ein Zusammenspiel, das die Unvollkommenheit und Vergänglichkeit in den Vordergrund rückt und dennoch eine beständige Schönheit offenbart.
So erforscht Toiles auf einzigartige Weise die Verbindung zwischen Sprache und Bildkunst. Die Erzählungen setzen sich mit Wahrnehmung, künstlerischer Repräsentation und der Flüchtigkeit von Eindrücken auseinander. Jede Geschichte greift dabei nicht nur eine bestimmte malerische Technik auf, sondern überträgt diese in eine literarische Form, sodass sich das Buch als ein intermediales Experiment lesen lässt. Der Titel Toiles (frz. „Leinwände“) verweist auf das zentrale Motiv des Buches: Jede Erzählung ist wie eine eigenständige Leinwand, auf der sprachliche Bilder entstehen. Doch der Begriff toile bedeutet nicht nur „Gemälde“, sondern auch „Netz“, „Gewebe“, „Text“. Die Leinwand ist zudem ein Medium der Fixierung und der Illusion: Sie hält einen Moment fest, der in der realen Welt flüchtig ist, und erzeugt gleichzeitig eine Darstellung, die nicht identisch mit der Realität ist. Diese Spannung zwischen Dauer und Vergänglichkeit, zwischen Illusion und Wirklichkeit, ist ein zentrales Thema des Werks.
Man sieht nichts
Le 11 mai 2020, elle regarda au-dehors ; elle regarda au-dedans. Elle se souvint que le poème fait image, que le poème fait monde ; elle se souvint que le poème, comme la langue, en nommant, façonne, figure. Fait fiction. Elle ouvrit un dictionnaire, et, au mot « fiction », elle lut ceci : « Produit de l’imagination qui n’a pas de modèle complet dans la réalité. » Elle se dit que, oui, le poème était bien cela. Un produit de l’imagination sans modèle complet dans la réalité. Où la réalité, par le poème, se révélait soudain incomplète, quand on avait si longtemps conçu l’inverse, c’est-à-dire que c’était la représentation, c’est-à-dire que c’était le langage qui étaient condamnés à demeurer incomplets.
De nouveau, elle regarda au-dehors. Il pleuvait. Elle songea qu’imaginer le monde de demain pouvait être imaginer cela : un monde que le poème ferait complet, quand la réalité y était impuissante.
Gribinski, Toiles, „Portrait des lents demains (Perspective, Intérieur)“
Am 11. Mai 2020 blickte sie nach draußen; sie blickte nach innen. Sie erinnerte sich daran, dass das Gedicht ein Bild macht, dass das Gedicht die Welt macht; sie erinnerte sich daran, dass das Gedicht, wie die Sprache, indem sie benennt, formt, figuriert. Es macht Fiktion. Sie schlug ein Wörterbuch auf und las bei dem Wort „Fiktion“ Folgendes: „Produkt der Einbildungskraft, das kein vollständiges Vorbild in der Realität hat.“ Sie dachte, ja, das Gedicht war genau das. Ein Produkt der Phantasie ohne vollständiges Vorbild in der Realität. Wo sich die Realität durch das Gedicht plötzlich als unvollständig erwies, wo man doch so lange das Gegenteil gedacht hatte, nämlich dass die Darstellung, die Sprache, dazu verurteilt war, unvollständig zu bleiben.
Wieder schaute sie nach draußen. Es hatte geregnet. Sie dachte daran, dass die Welt von morgen so aussehen könnte: eine Welt, die das Gedicht vollständig machen würde, wenn die Realität machtlos war.
Die literaturwissenschaftliche Relevanz von Toiles liegt in seiner intermedialen Struktur: Jede Geschichte zeigt, dass Sprache nicht nur ein narratives, sondern auch ein visuelles Medium ist. Gribinski nutzt Beschreibungen, Kompositionen und sprachliche Techniken, um den Effekt von Malerei nachzuahmen. So entsteht eine Art „sprachliches Gemälde“, das sich auf der Leinwand der Vorstellungskraft des Lesers entfaltet. Die Erzählungen adaptieren künstlerische Techniken wie Anamorphose, Trompe-l’œil oder Freskenmalerei in erzählerische Strategien. Perspektivwechsel, Unschärfen, Detailgenauigkeit oder Farbspiel werden sprachlich umgesetzt, sodass jedes Narrativ nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern auch ein ästhetisches Experiment ist. Viele der Geschichten thematisieren die Fragilität und Subjektivität des Sehens. Der Blick, die Perspektive und die Illusion sind wiederkehrende Motive, die darauf hinweisen, dass sowohl Kunst als auch Literatur nicht die Realität abbilden, sondern Wirklichkeiten konstruieren. Toiles zeigt, dass es in der Kunst immer ein Spannungsfeld zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem gibt. In „Clôture – On n’y voit rien“ wird dies explizit gemacht: Manche Dinge entziehen sich der direkten Wahrnehmung, und ebenso kann Literatur nicht alles in Sprache fassen. Diese Reflexion über das Sagbare erinnert an den philosophischen Diskurs um die Grenze der Sprache (etwa bei Wittgenstein). Gribinski gelingt mit Toiles eine literarische Annäherung an die Malerei, die über eine bloße Beschreibung von Kunst hinausgeht. Das Buch zeigt, dass Literatur und bildende Kunst nicht isolierte Medien sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen und herausfordern. In literaturwissenschaftlicher Hinsicht bietet Toiles eine Fallstudie für intermediale Erzählstrategien: Es zeigt, wie literarische Texte malerische Verfahren nachbilden können, und demonstriert, dass Literatur nicht nur durch ihre Geschichte, sondern auch durch ihre formale Gestaltung eine ästhetische Erfahrung ermöglicht – ähnlich wie ein Gemälde. Toiles ist damit nicht nur eine Sammlung von Erzählungen, sondern ein Manifest für das Sehen, Schreiben und Wahrnehmen als kreative Akte.
Die Erzählung „Le grand pan de mur noir – (Anamorphose, Extérieur)“ spielt im urbanen Raum, an einem Ort, der zugleich öffentlich und intim wirkt – etwa in oder nahe einem Café, wo Licht und Schatten an Fassaden, Trennwänden oder in den Durchgängen der Stadt inszeniert werden. Zentral ist der Blick auf einen markanten, dunklen Wandabschnitt, den „grand pan de mur noir“. Diese Fläche dominiert die Wahrnehmung des Protagonisten und wird zum Ausgangspunkt für seine gedanklichen Wanderungen. Der Protagonist nimmt eine Frau wahr, die in einem Buch vertieft ist. Während er sie beobachtet, schweifen seine Gedanken und Assoziationen ab. Er bemerkt, wie Licht und Schatten sich über den Wandabschnitt bewegen, wie die Umgebung – inklusive eines vorüberziehenden Hundes – in ständiger Veränderung begriffen ist. Die scheinbar monotone, dunkle Wand wird dabei zum Träger eines vielschichtigen Bildes: Sie ist zugleich leer, und doch reich an verborgenen Bedeutungen, die sich im Zusammenspiel von Licht, Schatten und dem flüchtigen Moment entfalten. Der Erzähler der zweiten Geschichte versucht, die Welt zu deuten, doch das Bild bleibt flüchtig und wandelbar, ähnlich wie ein barockes Trompe-l’œil. Die Geschichte „Le grand pan de mur noir – (Anamorphose, Extérieur)“ greift Wahrnehmungseffekte und Intermedialität zwischen Malerei, Fotografie und Literatur auf. Der Titel verweist bereits auf zwei zentrale Konzepte: den „großen schwarzen Wandabschnitt“ als visuelles Motiv und die „Anamorphose“ als Wahrnehmungstäuschung oder verzerrte Darstellung, die erst aus einer bestimmten Perspektive Sinn ergibt. Die scheinbar homogene, schwarze Wand enthüllt – bei genauerem Hinsehen und aus einem bestimmten Winkel – verborgene Details und Bedeutungen. Diese Illusion steht sinnbildlich für die Unzuverlässigkeit des Sehens: Was auf den ersten Blick als Leere erscheint, birgt bei näherer Betrachtung komplexe Strukturen. Inhaltlich beschreibt die Geschichte eine Außenansicht – ein urbanes oder architektonisches Bild, das sich der direkten Deutung entzieht. Der schwarze Wandabschnitt kann als Projektionsfläche für Assoziationen verstanden werden, als Ort, an dem sich Realität und Imagination überschneiden. Die Anamorphose als künstlerisches Verfahren verstärkt diese Vieldeutigkeit: Was zunächst als abstraktes, unverständliches Bild erscheint, kann sich je nach Blickwinkel verändern oder einen verborgenen Sinn offenbaren. In der Geschichte bedeutet das, dass Realität und Wahrnehmung instabil sind. Diese Idee spiegelt sich auch auf der narrativen Ebene wider. Der Text spielt mit verschiedenen medialen Bezügen, indem er nicht nur visuelle Wahrnehmung, sondern auch die sprachliche Beschreibung dieser Wahrnehmung thematisiert. Dabei entsteht eine Spannung zwischen direkter Erfahrung und künstlerischer Vermittlung. Die Intermedialität zeigt sich insbesondere in der Art und Weise, wie die Geschichte fotografische und malerische Techniken aufgreift: Sie evoziert das Bild einer Wand als potenzielle Leinwand, auf der sich Bedeutungen überlagern und verschieben. In einem weiteren Sinne könnte der schwarze Wandabschnitt auch als Metapher für das Unbekannte oder das Unausgesprochene dienen – eine Fläche, die darauf wartet, interpretiert oder neu gestaltet zu werden. Durch die Bezugnahme auf die Anamorphose legt der Text nahe, dass Bedeutung immer perspektivisch ist und von der Position des Betrachters abhängt.
Das Anamorphe entsteht aus mehreren ineinandergreifenden Elementen: eine sich verflüssigende Perspektive, eine ambivalente Erscheinung, ein Vermischen von Traum und Wirklichkeit, ein Ineinandergreifen von Bild und Sprache, schließlich die Unmöglichkeit einer klaren Realität: Die Wahrnehmung des Protagonisten ist unstetig, zwischen objektiver Beobachtung und subjektiver Projektion. Die Welt um ihn herum ist kein statischer Raum, sondern ein sich ständig wandelndes Bild. Figuren und Objekte verlieren ihre Konturen, lösen sich im Hintergrund auf oder gehen nahtlos ineinander über. Die junge Frau ist sowohl ein Individuum als auch eine Idee, ein Gemälde, eine Projektion seiner eigenen Gedanken. Die Wandfläche wird zur Projektionsfläche seines Bewusstseins, das sich in sie hineinverliert. – Farben und Formen verändern sich je nach Perspektive, Licht und Reflexion. Schwarz ist nicht wirklich schwarz, Orange scheint sich auf Hauttöne zu übertragen, der Schatten einer Figur wird zur selbstständigen Entität. Der Text thematisiert dieses Spiel mit optischen Illusionen direkt („Schwarz war nicht schwarz, genauso wenig wie blau blau war“). Die Welt ist wie eine übermalte Leinwand, auf der Spuren früherer Zustände durchscheinen, als wäre die Realität ein Palimpsest. – Das Motiv des endlosen Falls, das wiederholt auftaucht, verweist auf einen traumähnlichen Zustand. Auch das Motiv der Abwesenheit ist zentral: Die Frau scheint nicht wirklich zu existieren, ebenso wenig wie der Hund, der immer wieder auftaucht und verschwindet. Die Wirklichkeit ist hier nicht stabil, sondern ein flüchtiges Konstrukt, das sich in einem Wechselspiel zwischen Sehen und Imaginieren immer neu formt. – Der Text reflektiert sich selbst als ein Bild innerhalb eines Bildes, als ein „Picture, as a fiction factory“. Er verweist nicht nur auf Malerei, sondern inszeniert sich selbst als ein solches anamorphotisches Konstrukt: Was zunächst eine lineare Erzählung zu sein scheint, wird nach und nach zu einer Fläche, in der Bedeutungen sich überlagern, verschieben und auflösen. Die Sprache selbst wird zur Bildfläche, zur Verdichtung von Wahrnehmungsschichten. – Der Erzähler versucht, eine Ordnung in seine Wahrnehmung zu bringen, doch alles bleibt flüchtig. Er sucht nach logischen Zusammenhängen, aber die Bilder gehorchen nicht einer rationalen Struktur, sondern dem Zufall, der Assoziation, der subjektiven Verzerrung. Die Welt erscheint nicht mehr als objektive Gegebenheit, sondern als ein System von Spiegelungen und Reflexionen, das sich jeder fixen Interpretation entzieht. – Insgesamt erzeugt der Text eine anamorphe Erzählweise, indem er Sehen und Vorstellung, Realität und Fiktion, Außenwelt und Innenwelt unaufhörlich ineinander verschiebt. Die Wahrnehmung bleibt nie stabil, sondern verwandelt sich mit jeder neuen Perspektive – genau wie in einem anamorphotischen Bild, das nur aus einem bestimmten Blickwinkel eine kohärente Form annimmt. Ähnlich wie in einem anamorphotischen Gemälde, in dem verschiedene Bildebenen übereinandergelegt werden, schichtet der Text äußere Beobachtungen mit inneren Assoziationen. Der Protagonist ordnet Details – das Verschwinden eines Hundes, die flüchtige Erscheinung einer Leserin, die Wirkung der Dunkelheit – zu einem komplexen Bild, das nur im Zusammenspiel aller Elemente seine volle Bedeutung entfaltet. Die Sprache spielt mit dem Spannungsfeld zwischen dem, was sichtbar ist, und dem, was verborgen bleibt. Die scheinbare Leere des „mur noir“ wird zu einem Träger für verborgene Inhalte, die erst unter einem bestimmten Licht (sowohl wörtlich als auch metaphorisch) erkennbar werden.
Je pensais que ce qui était plus prodigieux encore était que ce que voyait en réalité le peintre se trouvait finalement exclu de la représentation : durant la pose, le nu lui faisait face. Et le miroir montrait en même temps ce que, directement, lui ne pouvait voir. Esse est percipi…
Elsa Gribinski, Toiles, „On n’y voit rien“.
Ich dachte, das noch Wunderbarere sei, dass das, was der Maler in Wirklichkeit sah, letztlich von der Darstellung ausgeschlossen war: Während der Pose stand der Akt ihm gegenüber. Und der Spiegel zeigte gleichzeitig das, was er direkt nicht sehen konnte. Esse est percipi …
In Gribinskis Abschlusstext „Clôture: on n’y voit rien“ („Man sieht nichts“) entfaltet sich eine geheimnisvolle Geschichte, die sich um die Wahrnehmung von Kunst und Realität dreht. Der Protagonist, ein Maler, wird von einer mysteriösen Leinwand angezogen, die auf unerklärliche Weise sein eigenes Schicksal zu beeinflussen scheint. Während er daran arbeitet, das Bild zu vervollkommnen, verschwimmen die Grenzen zwischen seiner eigenen Existenz und der dargestellten Szene. Er verliert sich zunehmend in der Welt der Kunst, bis die Malerei nicht mehr nur ein Spiegel, sondern eine sich verselbstständigende Realität wird. Am Ende bleibt unklar, ob der Protagonist in seiner Kunst verschwindet oder ob er sich jemals von ihr lösen kann. Die Leinwand in der Geschichte ist nicht nur ein Objekt innerhalb der Erzählung, sondern übernimmt eine narrative Funktion. Sie bestimmt das Schicksal des Protagonisten und stellt ein Medium dar, durch das sich die Wirklichkeit verändert. Die Erzählstruktur schafft eine Mise en abyme, eine Verschachtelung, indem das Bild innerhalb der Erzählung eine Realität entwirft, die sich wiederum auf die erzählte Welt auswirkt. Dies ist ein typisches intermediales Verfahren, bei dem sich verschiedene Medien gegenseitig reflektieren. Der Text thematisiert die Wirkung von Bildern auf den Betrachter und verhandelt Fragen der Kunsttheorie. Die Malerei dient als Spiegel der Realität, aber auch als eigenständige, transformative Kraft. Der Erzählstil arbeitet mit bildhaften Beschreibungen, die an Techniken der Malerei erinnern, etwa durch Chiaroscuro-Spiele oder die detaillierte Wiedergabe von Farbkompositionen.
Der Schlusstitel „On n’y voit rien“ aus Elsa Gribinskis Erzählsammlung Toiles lässt sich auf mehreren Ebenen interpretieren. Die Szene, in der ein Museumsführer selbst zum Hindernis der Sicht auf das Kunstwerk wird, kann als Kritik an institutionalisierter Kunstvermittlung verstanden werden. Anstatt den Blick zu öffnen, versperren Autoritäten oder das System selbst die Wahrnehmung. Der Titel verweist aber grundlegender auf eine Situation der Verhüllung, in der Sehen erschwert oder unmöglich wird. Im letzten Abschnitt des Textes wird eine Szene beschrieben, in der Menschen sich vor einem Kunstwerk versammeln, aber durch ihre eigene Anwesenheit die Sicht darauf versperren. Dies könnte als Metapher für die Art und Weise verstanden werden, wie wir Kunst, Realität oder Wahrheit oft nur unvollständig oder verzerrt wahrnehmen. Das Motiv des „Nichtsehens“ steht in Zusammenhang mit der Reflexion über die Kunstgeschichte, insbesondere mit dem Manierismus (Pontormo, Bronzino) und der Entwicklung der Malerei. Die Idee, dass Kunst einerseits zur Enthüllung, andererseits aber auch zur Verschleierung beitragen kann, wird hier ironisch aufgegriffen. Der Untertitel Des images, intérieures, extérieures betont das Spannungsverhältnis zwischen äußeren und inneren Bildern. „Man sieht nichts“ könnte darauf hindeuten, dass das Entscheidende nicht das Sichtbare ist, sondern das, was sich in der Vorstellung abspielt oder was durch Interpretation erschlossen werden muss.
— Les grands oiseaux. On ne touche pas les grands oiseaux. Tu as raison : il peignait ce qui ne se touche pas. On ne touche pas les yeux. On ne touche pas non plus les mains d’un peintre. Sauf que c’était comme si, en peignant, il voulait toucher ceux des autres. Et toucher ce qui, une fois peint, serait interdit au toucher. On ne touche pas les toiles, n’est-ce pas ?
— Dans les galeries, dans les musées, on ne les touche pas. Mais dans l’atelier… Le peintre peut toucher ses toiles. Peut-être ne le fait-il pas, mais il le peut.
Gribinski, Toiles, „Autoportrait (Conversation piece, Intérieur)“
— Die großen Vögel. Große Vögel berührt man nicht. Du hast Recht: Er malte das, was man nicht berührt. Man berührt nicht die Augen. Man berührt auch nicht die Hände eines Malers. Nur war es so, dass er beim Malen die Hände anderer berühren wollte. Und etwas berühren, das nach dem Malen nicht mehr berührt werden darf. Leinwände werden nicht berührt, oder?
— In Galerien, in Museen werden sie nicht berührt. Aber im Atelier … Der Maler darf seine Leinwände berühren. Vielleicht tut er es nicht, aber er kann es.