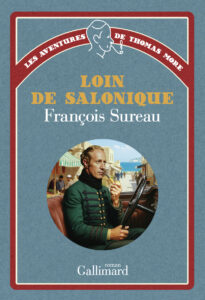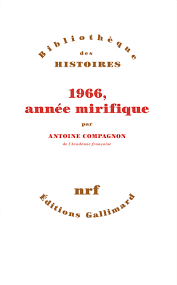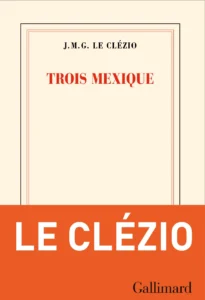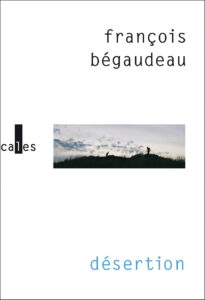Historische Wahrheit im Zeitalter von KI und Identitätspolitik: Jean-Frédéric Schaub
Jean-Frédéric Schaubs Streitschrift „Le passé ne s’invente pas“ bringt die Geschichtswissenschaft als letzte Bastion gegen Desinformation, digitale Manipulation und identitäre Geschichtspolitik in Stellung. Vor dem Hintergrund generativer KI, politischer Propaganda und eines wissenschaftsfeindlichen Relativismus entwirft Schaub eine ebenso methodische wie politische Verteidigung der historischen Wahrhaftigkeit: Geschichte, so seine These, ist keine literarische Spielart, sondern eine auf materielle Spuren gegründete Wissenschaft, deren Kern die Anerkennung der „Unverfügbarkeit“ der Vergangenheit bildet. Die Rezension zeichnet nach, wie Schaub sich gegen uchronische Entwürfe wie Binets „Civilizations“, gegen narrative Theorien im Gefolge von Hayden White und gegen „reparative“ Imaginationen – etwa bei Saidiya Hartman – abgrenzt, während er Autoren wie Patrick Modiano und dessen „Dora Bruder“ als Beispiel einer literarischen Ethik des Verzichts würdigt. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob das Aushalten der Lücken – statt ihrer poetischen Auffüllung – tatsächlich die einzig legitime Form epistemischer Gerechtigkeit darstellt. Die Besprechung arbeitet die innere Logik von Schaubs Argumentation heraus, beleuchtet seine Kritik an Relativismus und „Ventriloquismus“ und diskutiert, inwiefern seine strikte Grenzziehung zwischen Wissenschaft und Literatur im Zeitalter hybrider Formen überzeugt – oder neue Spannungen zwischen Faktentreue und moralischer Imagination erzeugt.
➙ Zum Artikel