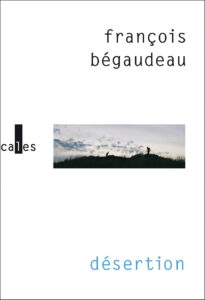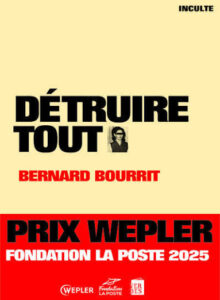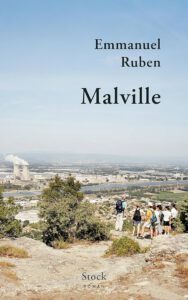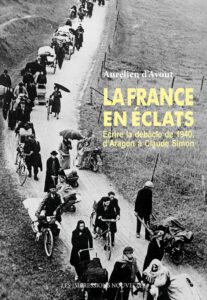Vom Wilden Denken zum Ackerbauern: Das Rad im Sumpf bei Mathias Énard
„Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs“ (Actes Sud, 2020, ins Deutsche von Holger Fock und Sabine Müller, Hanser, 2021) von Mathias Énard folgt dem Pariser Ethnologiestudenten David Mazon in das abgelegene La Pierre-Saint-Christophe im Poitou. Was als Feldforschung beginnt, entfaltet sich zu einer Initiationsgeschichte: David versucht, das Dorf mit den Instrumenten von Claude Lévi-Strauss und Bronisław Malinowski zu vermessen, führt Kategorien, Transkriptionen und Tabellen, während um ihn herum eine Wirklichkeit pulsiert, die sich nicht in Begriffe bannen lässt. Parallel dazu öffnet sich eine zweite, metaphysische Ebene: Die Seelen der Toten kehren in immer neuen Gestalten zurück, durchwandern Schlachten, Religionskriege, Revolutionen und Weltkriege, bis sie im heutigen Ackerboden als Würmer, Wildschweine oder Bauern wiedererscheinen. Im Zentrum steht das grotesk-opulente Bankett der Totengräberbruderschaft in der Abtei von Maillezais – eine Rabelais’sche Orgie aus Speisen, Schnaps und Debatten, in der der Tod nicht verdrängt, sondern gefeiert wird. Am Ende gibt der Feldforscher David seine Dissertation auf und gründet mit Lucie einen Biohof: Die Theorie weicht der Arbeit, die Beobachtung der Teilhabe. – Der Aufsatz arbeitet heraus, dass dieser Handlungsbogen keine idyllische Rückkehr zur Natur inszeniert, sondern eine systematische Entmachtung des akademischen Blicks. Zunächst erscheint das Dorf als „Neuer Kontinent“, die Bewohner als Untersuchungsobjekte – ein ironisch gebrochener Nachvollzug kolonialer Ethnographie. Doch Methode und Wirklichkeit geraten auseinander: Dialekt, Körperlichkeit, Tod und Arbeit unterlaufen jede begriffliche Ordnung. Die Intertextualität – von François Rabelais bis François Villon – wirkt hier als poetologisches Instrument: Sie relativiert die Autorität der Theorie, indem sie sie in Überfülle, Groteske und (buchstäblich!) in Stoffwechsel auflöst. Die Interpretation deutet den ländlichen Raum im Roman als Palimpsest aus Weltgeschichte, bäuerlicher Praxis und ökologischer Gegenwart, in dem Tod und Fruchtbarkeit, Verrotten und Zukunft untrennbar verschränkt sind. Erkenntnis entsteht hier nicht aus Distanz, sondern aus Erdverbundenheit – als radikale, politische Umwertung dessen, was Wissen heißen kann.
➙ Zum Artikel