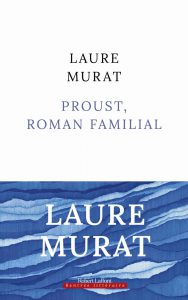Les mondes mettent longtemps à mourir, plus encore à disparaître tout à fait. Ils cohabitent plutôt, se superposent et traînent dans le temps. Ils se prolongent et s’éternisent, par la voix des témoins qui, de récits en conversations, de souvenirs en affabulations, passent le relais, dans un chant en canon qui se perd en échos interminables. Dès l’adolescence, j’ai aimé me trouver dans l’orbe de gens âgés, très âgés parfois, dont la façon de parler, les expressions, les intonations venaient d’une autre époque. Il me semblait que, par eux, je pouvais entendre le passé, seule façon de lui donner corps et, partant, de l’imaginer. Le fétichisme de ma quête s’accommodait d’approximations. Je me souviens d’un ami de mon père, le critique de cinéma Jean Domarchi, imitant Baudelaire, ou plutôt reproduisant l’imitation entendue de quelqu’un qui avait connu le poète… Baudelaire réincarné dans l’embrasure du salon ! Je vérifie sur Internet : Jean Domarchi est mort en janvier 1981. J’avais, au mieux, treize ans lorsque je l’ai entendu déclamer, mais je jure me souvenir comme hier de sa diction un peu sinueuse, sévère, comme retenue, corsetée, filtrant de lèvres quasi closes. La bouche de Baudelaire, sur la photographie de Carjat.
Dans cette traversée presque inintelligible des couches du temps, je me sens, à bien des égards, tombée en droite ligne et en chute libre du XIXe siècle. Mon père n’avait-il pas lui-même été élevé en partie par sa grand-mère, née en 1867, sous Napoléon III ? Celle-ci, descendante du maréchal Ney, ne chérissait-elle pas le souvenir de ce vieux jardinier de Trianon, vétéran de la Bérézina, qui faisait tournoyer sa cape pour lui montrer comment le maréchal la portait lors de la retraite de Russie ? Mon grand-père maternel, né en 1905, n’avait-il pas connu enfant le page de Charles X, alors vieillard cacochyme ? Ces doubles saltos arrière dans la chronologie me subjuguent. Ils me font penser à la marche du cavalier sur l’échiquier, la plus énigmatique, dont une version possible est : un pas de côté, deux en arrière. Parfois, une seule vie les ramasse, comme celle de mon arrière-arrière-grand-mère, la duchesse d’Uzès (1847-1933), née sous Louis-Philippe et morte à l’accession d’Hitler au pouvoir. Et je ne laisse de m’étonner qu’Arthur Rimbaud (1854-1891) et Philippe Pétain (1856-1951), nés à dix-huit mois d’écart, aient donc été congénères, dans un arc temporel qui enjambe les débuts du Second Empire et l’après-Seconde Guerre mondiale, ou que la petite-fille de George Sand ait pu témoigner à la télévision en 1961, à quatre-vingt-quinze ans, des déjeuners à la table de sa grand-mère, où elle était assise à côté de Flaubert.
Très tôt, j’ai su remonter le temps sans effort, en me constituant une mémoire par procuration, dépositaire de souvenirs que je n’avais pas vécus. Tout me semblait à portée de main, comme s’il suffisait de jouer à la marelle pour accéder à une époque improbable, atteinte en quelques cases parcourues à cloche-pied. Il n’y avait, au fond, par le truchement de mon père et de son éducation, qu’un degré de séparation entre moi et la société décrite dans À la recherche du temps perdu, univers à l’évidence lointain, révolu, et pourtant si familier.
Aujourd’hui encore, je ne me lasse pas d’écouter Louis Gautier-Vignal, Paul Morand ou Jean Cocteau, enregistrés par la radio ou la télévision, imiter la voix mélodieuse de Proust – imitations dont la concordance renforce l’effet de vérité. Les nombreux entretiens avec Céleste, dont on confondait la voix au téléphone avec celle de son maître, apportent une indication supplémentaire sur la prosodie proustienne, musicale et légèrement traînante. Et j’eusse été mille fois plus émue d’entendre Proust dérouler sa phrase interminable, même sur un vieux gramophone grésillant, que de saisir sa (supposée) silhouette au vol dans ce petit bout de film de 1904 récemment retrouvé où l’on voit un jeune homme pressé en chapeau melon descendre l’escalier de la Madeleine à la sortie du mariage d’Elaine Greffulhe et d’Armand de Guiche. Laure Murat, Proust, roman familial (Robert Laffont, 2023)
Tous les témoins s’accordent sur un fait : Proust parlait comme dans son livre, il n’y avait pas de différence entre sa phrase orale et sa phrase écrite. « Sa parole lente et continue. Extraordinaire abondance d’incidentes, mais sans que jamais le fil se perdît », note Jacques Rivière. Une seule et même phrase, confirme Paul Morand, « très chantante, qui n’en finissait jamais, pleine d’incidentes, d’objections qu’on ne songeait pas à formuler mais qu’il formulait lui-même. Elle ressemblait à une route de montagne qu’on gravissait sans jamais arriver au sommet. Beaucoup d’incidentes, qui soutenaient la phrase comme des espèces de ballonnets d’oxygène et qui l’empêchaient de retomber, pleine d’arguties, d’arborescences, tout ça très fluide, très doux. Très doux et en même temps très viril ». Car la voix de Proust, qui roule dans mon oreille de lectrice et de voyageuse à l’intérieur du temps, était « insinuante mais autoritaire ».
Welten brauchen lange, um zu sterben, und noch länger, um ganz zu verschwinden. Vielmehr koexistieren sie, überlagern sich und ziehen sich durch die Zeit. Sie verlängern und verewigen sich durch die Stimmen der Zeugen, die von Erzählungen zu Gesprächen, von Erinnerungen zu Fabulierstücken, den Staffelstab weitergeben, in einem kanonartigen Gesang, der sich in endlosen Echos verliert. Schon als Jugendliche habe ich es genossen, von älteren, manchmal sogar sehr alten Menschen umgeben zu sein, deren Art zu sprechen, deren Ausdrücke und Betonungen aus einer anderen Zeit stammten. Es schien mir, dass ich durch sie die Vergangenheit hören konnte, denn nur so konnte ich dieser Gestalt verleihen und sie mir dadurch vorstellen. Meine fetischartige Suche nahm Ungenauigkeiten in Kauf. Ich erinnere mich, wie ein Freund meines Vaters, der Filmkritiker Jean Domarchi, Baudelaire imitierte, oder vielmehr die Imitation wiedergab, die er von jemandem gehört hatte, der den Dichter gekannt hatte … Baudelaire als Reinkarnation an der Türschwelle des Wohnzimmers! Ich schaue im Internet nach: Jean Domarchi starb im Januar 1981. Ich war bestenfalls dreizehn Jahre alt, als ich ihn deklamieren hörte, aber ich schwöre, dass ich mich wie gestern an seine etwas gewundene, strenge, wie zurückgehaltene, korsettartige Diktion erinnere, die von fast geschlossenen Lippen durchsickerte. Baudelaires Mund auf dem Foto von Carjat.
Bei diesem fast unbegreiflichen Durchqueren der Zeitschichten fühle ich mich in mehrfacher Hinsicht wie in gerader Linie und im Sturzflug aus dem 19. Jahrhundert gefallen. War mein Vater nicht selbst teilweise von seiner Großmutter erzogen worden, die 1867 unter Napoleon III. geboren wurde? War sie nicht eine Nachfahrin von Marschall Ney und hielt die Erinnerung an den alten Gärtner von Trianon hoch, einen Veteranen der Beresina, der seinen Umhang herumwirbelte, um ihr zu zeigen, wie der Marschall ihn beim Rückzug aus Russland trug? Hatte mein Großvater mütterlicherseits, der 1905 geboren wurde, nicht als Kind den Pagen von Karl X. kennen gelernt, der damals ein alter Greis war? Diese doppelten Rückwärtssaltos in der Chronologie überwältigen mich. Sie erinnern mich an den rätselhaften Weg des Springers auf dem Schachbrett, dessen möglicher Gang lautet: ein Schritt zur Seite, zwei Schritte zurück. Manchmal sammelt ein einziges Leben sie auf, wie das meiner Ur-Urgroßmutter, der Herzogin von Uzès (1847-1933), die unter Louis-Philippe geboren wurde und starb, als Hitler an die Macht kam. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass Arthur Rimbaud (1854-1891) und Philippe Pétain (1856-1951), die im Abstand von achtzehn Monaten geboren wurden, in einem Zeitbogen, der die Anfänge des Zweiten Kaiserreichs und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg überspannt, Zeitgenossen waren, oder dass die Enkelin von George Sand 1961 mit fünfundneunzig Jahren im Fernsehen von den Mittagessen am Tisch ihrer Großmutter berichten konnte, bei denen sie neben Flaubert saß.
Schon früh konnte ich mühelos in der Zeit zurückreisen, indem ich mir ein stellvertretendes Gedächtnis aufbaute, das Erinnerungen bewahrte, die ich nicht selbst erlebt hatte. Alles schien in greifbarer Nähe zu sein, als ob es genügte, Mühle zu spielen, um in eine unwahrscheinliche Epoche zu gelangen, die man in ein paar Feldern, die man mit dem Fuß überquerte, erreichte. Im Grunde gab es durch meinen Vater und seine Erziehung nur einen Spalt der Trennung zwischen mir und der Gesellschaft, die in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beschrieben wird, ein Universum, das offensichtlich weit entfernt, vergangen und doch so vertraut war.
Noch heute werde ich nicht müde, Louis Gautier-Vignal, Paul Morand oder Jean Cocteau zuzuhören, wenn sie Prousts melodische Stimme im Radio oder Fernsehen imitieren — Imitationen, deren Übereinstimmung den Effekt der Wahrheit noch verstärkt. Die zahlreichen Interviews mit Céleste, deren Stimme am Telefon mit der ihres Meisters verwechselt wurde, geben einen weiteren Hinweis auf Prousts musikalische und leicht schleppende Prosodie. Und es hätte mich tausendmal mehr gerührt, Proust seinen endlosen Satz selbst auf einem alten, knisternden Grammophon abspulen zu hören, als seine (vermeintliche) Silhouette in dem kürzlich gefundenen Filmschnipsel von 1904 zu erfassen, in dem man einen eiligen jungen Mann mit Melone die Treppe in der Madeleine hinuntergehen sieht, nachdem er die Hochzeit von Elaine Greffulhe und Armand de Guiche verlassen hat.
Alle Zeugen waren sich in einer Tatsache einig: Proust sprach wie in seinem Buch, es gab keinen Unterschied zwischen seinem gesprochenen und seinem geschriebenen Satz. „Sein langsames und kontinuierliches Sprechen. Außerordentliche Fülle von Beiläufigkeiten, aber ohne dass der Faden jemals verloren ging“, stellt Jacques Rivière fest. Ein und derselbe Satz, bestätigt Paul Morand, „sehr gesanglich, der nie endete, voller Zwischenfälle, Einwände, die man nicht zu formulieren gedachte, sondern die er selbst formulierte. Es war wie eine Bergstraße, die man hinaufsteigt, ohne jemals den Gipfel zu erreichen. Viele Zwischenbemerkungen, die den Satz wie eine Art Sauerstoffballon stützten und ihn daran hinderten, wieder abzufallen, voller Argumente und Bäume, alles sehr flüssig, sehr weich. Sehr weich und gleichzeitig sehr männlich“. Denn Prousts Stimme, die in meinem Ohr als Leserin und Zeitreisende klingt, war „andeutend, aber autoritär“. 1
- „Ein Roman, der über die emanzipatorische Kraft der Literatur nachdenkt, die auch eine Kraft des Trostes und der Versöhnung mit dem Leben ist. — Rentrée littéraire 2023 — Meine ganze Jugend hindurch hörte ich von den Figuren in À la recherche du temps perdu und war überzeugt, dass sie Cousins waren, die ich noch nicht kennengelernt hatte. Zu Hause vermischten sich die Sprüche von Charlus und die Gemeinheiten der Herzogin von Guermantes mit den am Tisch gehörten Bonmots, ohne dass es eine Kontinuität zwischen Fiktion und Realität gab. Denn die vergangene Welt, in der ich aufwuchs, war immer noch die Welt von Proust, der meine Urgroßeltern kannte, deren Namen in seinem Roman vorkommen. Mit etwa 20 Jahren las ich schließlich die Recherche. Und dann änderte sich mein Leben. Proust wusste besser als ich, was ich durchmachte. Er zeigte mir, wie sehr die Aristokratie ein Universum der leeren Formen ist. Noch bevor ich mit meiner eigenen Familie gebrochen hatte, bot er mir eine Meditation über das innere Exil, das diejenigen erleben, die sich von sozialen und sexuellen Normen abschrecken lassen. Proust hat mich nicht nur über meine Herkunft aufgeklärt. Er hat mich zu einem Subjekt gemacht, zu einem aktiven Leser meines eigenen Lebens, indem er mir die emanzipatorische Kraft der Literatur offenbarte, die auch eine Kraft des Trostes und der Versöhnung mit der Zeit ist.“ Übers. der Verlagsankündigung.>>>