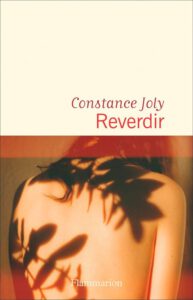Inhalt
In der narrativen Auseinandersetzung mit der Alzheimer-Erkrankung der Mutter präsentieren Constance Jolys Reverdir und Annie Ernaux’ Je ne suis pas sortie de ma nuit zwei gegensätzliche Pole der literarischen Gestaltung: Während Joly die Krankheit in eine hochgradig metaphorische Erzählung einbettet, die sich der Bilderwelt von Lewis Carrolls Alice im Wunderland, des „Lebens-Gänsespiels“ sowie einer botanischen Struktur bedient, um den Verfall als Teil einer persönlichen Blüte und der Rückgewinnung einer inneren „Wildheit“ zu deuten, wählt Ernaux die Form eines unmittelbaren, fragmentarischen Tagebuchs, das jede literarische Beschönigung zugunsten einer radikalen Dokumentation des physischen Verfalls als „Überrest eines Schmerzes“ ablehnt. Ernaux’ Aufzeichnungen fangen dabei die „Gewalt der Empfindungen“ und die „Stupeur“ (Bestürzung) angesichts der zunehmend „inhumanen“ Züge der Mutter ein, wobei die Demenz als ein unaufhaltsames „Versinken in der Nacht“ erscheint, aus der es für die Patientin keinen Ausweg mehr gibt. Im Gegensatz dazu begreift Joly die Erkrankung als Katalysator für eine existentielle Metamorphose der Tochter, die durch das Schwinden der mütterlichen Identität lernt, ihre eigenen Bedürfnisse jenseits lebenslanger Anpassung neu zu definieren und den Mut zum symbolischen „Wiederergrünen“ des Romantitels zu finden.
In Reverdir berichtet die etwa fünfzigjährige Erzählerin aus einer doppelten Krise: Während ihre Mutter zunehmend im Vergessen versinkt, zerbricht ihre eigene siebenundzwanzigjährige Ehe mit Yann. Joly strukturiert den Text botanisch in die Phasen „Blätter“, „Blüten“ und „Wurzeln“, was den Prozess des „Wiederergrünens“ figuriert. Die Affäre der Erzählerin mit dem „Homme-Montagne“ symbolisiert den schmerzhaften Sturz der Erzählerin in ein emotionales „Wunderland“, der zeitlich mit dem Alzheimer-Verfall ihrer Mutter und dem Ende ihrer Ehe zusammenfällt. Die Beziehung verdeutlicht ihr lebenslanges Muster des „Sich-Zurechtfeilens“ (raboter), bei dem sie ihre eigene Identität aufgibt, um den Wünschen eines Mannes zu entsprechen, der sich letztlich als unnahbarer „professioneller Verlasser“ entpuppt. Der endgültige Bruch mit ihm fungiert jedoch als notwendiger Katalysator für ihre Metamorphose, da sie durch die Überwindung dieses „erlöschenden Feuers“ den Weg zu einer eigenständigen Existenz und ihrer späten Blüte findet.
Mon beau-père, ma mère et moi attendons les résultats dans le couloir percé de néons […]. Le médecin délivre son diagnostic, et ma mère ne peut pas l’entendre. J’ai froid, dit-elle. Les ténèbres tombent sur elle, et je lui serre moi aussi la main. Là, ça me fait froid partout là, sur les bras. Le froid pour dire la peur. Pour dire l’haleine de la folie et de la mort. Je regarde ma mère disparaître dans le fauteuil de la salle d’attente, et je pense au miracle de sa naissance, cette nuit des accords de Munich. (Joly)
Mein Schwiegervater, meine Mutter und ich warten im neonbeleuchteten Flur auf die Ergebnisse […]. Der Arzt verkündet seine Diagnose, aber meine Mutter kann sie nicht hören. Mir ist kalt, sagt sie. Die Dunkelheit umhüllt sie, und auch ich drücke ihre Hand. Da wird mir überall kalt, an den Armen. Die Kälte als Ausdruck der Angst. Als Ausdruck des Hauchs des Wahnsinns und des Todes. Ich sehe meine Mutter im Sessel des Wartezimmers verschwinden und denke an das Wunder ihrer Geburt in der Nacht des Münchner Abkommens.
Dieser Auszug macht das Moment des existentiellen Schocks deutlich. Joly nutzt die physische Empfindung von Kälte als Metapher für die psychische Erstarrung angesichts der Alzheimer-Diagnose. Während der Arzt klinische Fakten liefert, erlebt die Mutter die Nachricht als ein „Einfrieren“ ihrer Welt, was die Tochter durch eine fast somatische Identifikation mitempfindet. Der Kontrast zwischen der klinischen Umgebung (Neonlicht) und der historischen Einbettung (Münchner Abkommen) zeigt, dass die Mutter hier nicht nur als Patientin, sondern als ein Wesen begriffen wird, dessen gesamte Lebensgeschichte nun in den „Ténèbres“ (Finsternis) zu verschwinden droht.

Je ne suis pas sortie de ma nuit ist hingegen ein fragmentarisches Tagebuch, das Annie Ernaux während der letzten Lebensjahre ihrer Mutter (1983–1986) führte. Es dokumentiert den klinischen und physischen Verfall der Mutter in einem Pflegeheim bis zu ihrem Tod durch eine Embolie. Ernaux verzichtet auf eine klassische Romanstruktur und präsentiert stattdessen Aufzeichnungen, die unmittelbar nach den Besuchen entstanden sind und die „Stupeur“ (Betäubung) sowie das Grauen des körperlichen Zerfalls festhalten.
C’est dans la période où elle était encore chez moi que je me suis mise à noter sur des bouts de papier, sans date, des propos, des comportements de ma mère qui me remplissaient de terreur. Je ne pouvais supporter qu’une telle dégradation frappe ma mère. Un jour, j’ai rêve que je lui criais avec colère : « Arrête d’être folle ! » Par la suite, quand je revenais de la voir à l’hôpital de Pontoise, il me fallait à toute force écrire sur elle, ses paroles, son corps, qui m’était de plus en plus proche. J’écrivais très vite, dans la violence des sensations, sans réfléchir ni chercher d’ordre. (Ernaux)
Es war in der Zeit, als sie noch bei mir wohnte, dass ich begann, auf Zetteln ohne Datum Äußerungen und Verhaltensweisen meiner Mutter zu notieren, die mich mit Schrecken erfüllten. Ich konnte es nicht ertragen, dass meine Mutter so sehr heruntergekommen war. Eines Tages träumte ich, dass ich sie wütend anschrie: „Hör auf, verrückt zu sein!“ Als ich sie später im Krankenhaus von Pontoise besuchte, musste ich unbedingt über sie schreiben, über ihre Worte, ihren Körper, der mir immer näher kam. Ich schrieb sehr schnell, in der Heftigkeit der Empfindungen, ohne nachzudenken oder nach einer Ordnung zu suchen.
Ernaux‘ Titel „Ich bin aus meiner Nacht nicht herausgekommen“ ist von einer existenziellen Schwere geprägt, da er den letzten Satz zitiert, den Ernaux’ Mutter vor dem vollständigen Verlust ihrer Schreibfähigkeit in einem Briefentwurf an eine Freundin niederschrieb. Er ist radikale Metapher für das Versinken in der Alzheimer-Erkrankung, die als eine permanente, ausweglose Dunkelheit begriffen wird, in der die Mutter als „verlorene Frau“ („femme égarée“) ihre Orientierung und Identität einbüßt. Diese „Nacht“ beschreibt einen schmerzhaften Zustand außerhalb der Zeit („hors du temps“), in dem die vertraute Mutter unter einer zunehmend „entmenschlichten“ Gestalt („figure inhumane“) verschwindet und die Tochter mit dem „Überrest eines Schmerzes“ („résidu d’une douleur“) zurücklässt. Der Titel benennt einen letzten luziden Hilfeschrei aus einem Bewusstsein, das sein eigenes Erlöschen im Vergessen für einen kurzen Moment noch selbst benennen konnte.
Vergleich der Erzählstränge: Metamorphose vs. Dokumentation
Ein wesentlicher Unterschied in den Erzählsträngen liegt in der Einbettung der Krankheit. Bei Joly ist der Alzheimer-Prozess der Mutter eng mit der existentiellen Neuerfindung der Tochter verknüpft. Der Text folgt einem Strang der persönlichen Entwicklung, einem „Spätblühen“, bei dem die Tochter lernt, ihre eigene „Wildheit“ zurückzugewinnen. Joly beschreibt dies als eine Art Aufbruch: „Ich war wie diese Vögel, die Neigung meines Körpers war auf den Abflug gespannt“ („J’étais comme ces oiseaux, l’inclinaison de mon corps était tendue vers l’envol“).
Bei Ernaux hingegen gibt es keinen narrativen Ausweg. Der Erzählstrang ist eine unaufhaltsame Abwärtsspirale in die Nacht des Todes. Es gibt keine Parallelhandlung von neuer Liebe oder beruflichem Erfolg; der Fokus bleibt klaustrophobisch auf dem Krankenzimmer und dem verfallenden Körper der Mutter. Ernaux beschreibt ihr Schreiben als den Versuch, den „Überrest eines Schmerzes“ („le résidu d’une douleur“) zu bewahren. Während Joly eine Geschichte der Befreiung erzählt, schreibt Ernaux eine Chronik des Unausweichlichen.
Zeitstruktur: Zyklus und Stillstand
Joly verwendet eine komplexe Zeitstruktur, die sie mit einem Gänsespiel vergleicht: eine Spirale aus Rückschlägen und Abkürzungen. Die Zeit ist hier fließend; Kindheitserinnerungen schieben sich in die Gegenwart der Pflege, und das Alter der Erzählerin (50 Jahre) wird als „Zwischenzeit“ wahrgenommen. Sie versucht, die Zeit „gegen den Strich“ zu nehmen und in die Vergangenheit zu flüchten. Das Bild des „Wiederergrünens“ impliziert eine zyklische Zeitwahrnehmung, in der nach dem Winter der Krankheit neues Leben möglich ist.
Bei Ernaux ist die Zeitstruktur durch die Datierung der Besuche, d.h. der Tagebucheinträge linear und zugleich statisch. Innerhalb des Heims scheint die Zeit verschwunden zu sein: „Im Inneren eine identische Wärme, Sommer wie Winter. Die Zeit ist verschwunden“ („À l’intérieur, une chaleur identique, été comme hiver. Le temps a disparu“). Die einzige zeitliche Bewegung ist die biologische Degeneration über etwa drei Jahre. Die Vergangenheit blitzt nur in schmerzhaften Vergleichen auf, wenn Ernaux das aktuelle Bild der Mutter mit der „starken Frau“ ihrer Kindheit kontrastiert: 1. der Beginn (1983), hier treten nach einem Unfall erste Gedächtnisverluste und Verhaltensauffälligkeiten auf. Die Mutter zieht zunächst zur Autorin nach Cergy; 2. die Verschlechterung (1984), wobei die Diagnose Alzheimer gestellt wird; die Mutter erkennt Angehörige nicht mehr und wird schließlich in das Krankenhaus von Pontoise eingeliefert; 3. die klinische Phase (1984–1986), mit einer Dokumentation der Besuche in der geriatrischen Abteilung, geprägt von physischer Degeneration, dem Verlust der Hygiene und der Sprache; schließtlich das Ende (April 1986), mit dem Tod der Mutter durch eine Embolie und den unmittelbaren Reflexionen der Autorin über diesen Verlust schließend.
Ernaux‘ fragmentarisches Tagebuch
Erzählerisch zeichnet sich Ernaux‘ Werk durch eine Poetik der Unmittelbarkeit aus, basierend auf dem Rohmaterial der Empfindung: Ernaux begann, Beobachtungen auf lose Zettel zu notieren, oft unmittelbar nach den Besuchen, getrieben von einem Gefühl des Entsetzens. Sie beschreibt diesen Prozess als Schreiben „in der Gewalt der Empfindungen, ohne nachzudenken oder eine Ordnung zu suchen“ („dans la violence des sensations, sans réfléchir ni chercher d’ordre“).
Sie verzichtet explizit auf literarische Überarbeitung: Die Autorin entschied sich Jahre später, die Notizen unverändert zu veröffentlichen. Sie betrachtet sie nicht als objektives Zeugnis, sondern als den „Überrest eines Schmerzes“ (le résidu d’une douleur). Die Erzählung ist durch Datumsangaben (Jahr und Monat) strukturiert, was den unaufhaltsamen Fortschritt der Zeit und der Krankheit betont. Werkgeschichtlich ist das Spannungsverhältnis zu Ernaux‘ Une femme bedeutsam: Die Autorin reflektiert in einem Vorwort und im Text selbst die Beziehung dieses Tagebuchs zu ihrem später erschienenen, eher biografisch-ordnenden Werk Une femme. Während Une femme eine „kohärente Wahrheit“ suchte, soll dieses Tagebuch diese Einheit bewusst „in Gefahr bringen“.
So wird Ernaux‘ Buch maßgeblich durch die Spannung zwischen der dokumentarischen Fixierung des Verfalls und dem schmerzhaften Aufblühen verdrängter Erinnerungen geprägt. Während die datierten Tagebucheinträge die „inhumane“ Gegenwart im Pflegeheim chronologisch festhalten, wirken die Besuche bei der Mutter wie ein erzählerisches „Echolot“, das tief in die Vergangenheit der Mutter-Tochter-Beziehung hinabreicht. Alltägliche, oft grauenhafte Details der Krankheit lösen dabei unmittelbare Assoziationen zu Fragmenten der eigenen Kindheit aus; so erinnert etwa der Anblick beschmutzter Wäsche die Erzählerin an Szenen aus ihrem siebten Lebensjahr oder an die einstige Strenge der Mutter. Diese Form der Introspektion bricht die lineare Zeit des biologischen Abbaus auf und macht das Buch zu einem Ort, an dem die „starke Frau“ von früher und der „Überrest eines Schmerzes“ in der Gegenwart gleichzeitig existieren.
Darüber hinaus manifestiert sich in der Zeitstruktur eine radikale Identifikation mit dem mütterlichen Körper, die die Grenzen zwischen den Generationen und zwischen dem Ich und dem Anderen verwischt. Ernaux beschreibt Zustände, in denen sie sich „außerhalb der Zeit“ fühlt und im physischen Leid der Mutter ihre eigene Vergänglichkeit vorweggenommen sieht: „Sie ist mein Alter“. Die Zeit wird hier nicht mehr als Fortschritt, sondern als unaufhaltsames Versinken in die Nacht wahrgenommen, wobei die Tochter beim Betrachten der Mutter gleichzeitig ihre eigene Kindheit wiedererlebt und ihre eigene Zukunft als alte Frau gespiegelt sieht. Diese narrative Gestaltung führt dazu, dass die Mutter für die Erzählerin zur Verkörperung der Zeit selbst wird, was die schmerzhafte Erkenntnis vertieft, dass der Tod der Mutter auch einen Teil der eigenen Identität unwiederbringlich auslöscht.
Kommunikationsformen: Poesie und körperliche Präsenz
Die Kommunikationsformen in den beiden Werken spiegeln die unterschiedlichen poetischen Ansätze der Autorinnen wider, wobei Constance Joly die Literatur als Brücke nutzt, während Annie Ernaux die körperliche Unmittelbarkeit in den Fokus rückt. In Reverdir ist die Kommunikation in der literarischen Tradition verwurzelt. Constance Joly beschreibt, wie die Erzählerin ihrer Mutter zum Geburtstag Rimbauds „Das trunkene Schiff“ („Le Bateau ivre“) rezitiert, ein Gedicht, das sie einst während des Stillens ihrer eigenen Tochter auswendig lernte. Trotz der fortgeschrittenen Demenz korrigiert die Mutter sogar eine Diärese im Vortrag der Tochter, was zeigt, dass die Literatur als stabiler Anker fungiert, der selbst dann noch greift, wenn die alltägliche Orientierung verloren gegangen ist. Die Sprache wird zwar „löchrig“ und die Mutter verwechselt Personen, doch bleibt die Poesie ein Instrument der emotionalen Annäherung und der gemeinsamen kulturellen Identität.
In diesem fragmentierten Sprachzustand entwickeln die Äußerungen der Mutter bei Joly eine fast prophetische Qualität. Joly charakterisiert die Demenz nicht primär als reinen Defizit-Zustand, sondern als eine Art alchemistischen Prozess, der die „unreinen Stoffe“ filtert und eine „reine Essenz des Seins“ zurücklässt. Die Sätze der Mutter blitzen vor existentieller Wahrheit auf und fordern die Tochter heraus, die neue, ungeschönte Identität der Mutter jenseits gesellschaftlicher Konventionen zu akzeptieren. Kommunikation wird hier zu einer Suche nach dem „Kern des Wesens“, der in den Trümmern der Vernunft aufleuchtet und die Tochter dazu bringt, ihre eigene „Wildheit“ (sauvagerie) zurückzugewinnen.
Im Gegensatz dazu rückt Annie Ernaux in Je ne suis pas sortie de ma nuit die physische Präsenz und pflegerische Akte in das Zentrum der Begegnung. Da die verbale Verständigung zunehmend scheitert, manifestiert sich die Beziehung in intimen körperlichen Handlungen: Die Erzählerin rasiert das Gesicht der Mutter, schneidet ihr die Nägel oder wäscht ihre verschmutzten Hände. Diese Gesten sind von einer schmerzhaften Unmittelbarkeit geprägt, die Ernaux als Rückkehr in eine „wiedergefundene kleine Kindheit“ beschreibt. Die Kommunikation verlagert sich fast vollständig auf das Tastbare und Sichtbare, wobei der zerfallende Körper der Mutter für die Tochter zur einzigen verbliebenen, grausamen Wahrheit wird.
Die Sprache der Mutter bei Ernaux verliert ihre poetische Kraft und zerfällt in primäre Obsessionen, die oft um Nahrung, Geld oder die Angst vor der „Patronne“ kreisen – allesamt Relikte einer durch Armut geprägten Vergangenheit. Die Kommunikation reduziert sich auf das Körperliche und Instinktive, wie das vorvöllige, gierige Essen oder das Tasten nach dem „kleinen Ramoneur“ am Bett. Der Titel des Werkes, „Je ne suis pas sortie de ma nuit“, markiert als letzter schriftlicher Überrest der Mutter den endgültigen Rückzug in eine unerreichbare innere Dunkelheit. Während Joly also die Sprache nutzt, um den Funken des Individuums zu bewahren, dokumentiert Ernaux das Verlöschen der Sprache als den ultimativen Verlust der menschlichen Weltzugehörigkeit.
Man könnte die Kommunikation in diesen Stadien mit einem Leuchtturm vergleichen: Bei Joly sendet er in der Dunkelheit noch immer rhythmische Signale in Form von Versen aus, während er bei Ernaux bereits erloschen ist und die Tochter sich nur noch am kalten Stein des Turms vortasten kann, um die Anwesenheit der Mutter zu spüren.
Metaphorik: Wunderland und Botanik gegen nackte Realität
Die Metaphorik ist das Feld der größten poetischen Diskrepanz: Joly arbeitet hochgradig metaphorisch. Sie nutzt Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“, um den Sturz in die Krankheit und die Orientierungslosigkeit der Liebe zu beschreiben. Die Mutter ist diejenige, die „den Kopf verliert“, während die Tochter in den „Bau des weißen Kaninchens“ rutscht. Die Botanik liefert weitere Metaphern: Die Resilienz der Pflanzen dient als Vorbild für das menschliche Überleben. Die botanische Gliederung in die Phasen „Blätter“, „Blüten“ und „Wurzeln“ macht die existenzielle Metamorphose der Erzählerin anschaulich, die parallel zum geistigen Verfall ihrer Mutter verläuft.
Die Phase der „Blätter“ repräsentiert den Ausgangspunkt der Krise, charakterisiert durch Vulnerabilität und den Beginn eines Zerfalls. Joly zitiert hierzu: „Der Ursprung sind die Blätter, zerbrechlich, verletzlich und doch fähig, zurückzukehren und wieder aufzuleben, nachdem sie die schlechte Jahreszeit durchquert haben“ („L’origine ce sont les feuilles, fragiles, vulnérables et pourtant capables de revenir et de revivre après avoir traversé la mauvaise saison“). In diesem Teil erlebt die Erzählerin den doppelten Schmerz durch die Alzheimer-Diagnose der Mutter und die Trennung von ihrem Geliebten, dem „Homme Montagne“. Wie Herbstblätter, die fallen, fühlt sie sich „wie ein Nippes kurz vor dem Zerbrechen“. Die Metaphorik verdeutlicht, dass dieser Zustand des „Abfallens“ notwendiger Teil eines natürlichen Zyklus ist, der ein späteres Wiederergrünen erst ermöglicht.
Die Phase der „Blüten“ steht für eine instabile, aber schöpferische Phase der Neuausrichtung. Joly beschreibt die Blüte als einen „vergänglichen, instabilen Körper, der es erlaubt, die Welt aufzusaugen und ihre wertvollsten Formen zu filtern, um von ihnen verändert zu werden“ („La fleur est un corps éphémère, instable, qui permet d’absorber le monde et d’en filtrer les formes les plus précieuses pour en être modifié“). Dieser Teil korrespondiert mit der Begegnung mit Pierre und der Realisierung, eine „Spätblüherin“ (late bloomer) zu sein. Mit 53 Jahren empfindet die Erzählerin ein „Aufbrechen aus ihrer Hülle“. Die Blüte symbolisiert hier die Bereitschaft, sich dem „schönen Risiko des Lebens“ erneut zu öffnen, wobei die Liebe als transformierende Kraft wirkt, die das Ich „modifiziert“.
Die Phase der „Wurzeln“ bildet das Fundament der Identität und steht für das Wesenhafte, das unter der Oberfläche verborgen liegt. Die Wurzel wird als ein „zweiter Körper, geheimnisvoll, esoterisch, latent“ beschrieben, der „alles umkehrt, was der andere Körper an der Oberfläche tut“ („La racine est comme un d’euxième corps, secret, ésotérique, latent, qui renverse tout ce que l’autre corps fait à la surface“). In diesem finalen Abschnitt findet die Erzählerin zu ihrer eigenen Stärke zurück, was durch den Kräuterkunde-Kurs in der Drôme unterstrichen wird. Die Metaphorik bezieht sich auf die Lehre ihres Vaters, die Dinge „an der Wurzel zu fassen“. Die Wurzel symbolisiert die Resilienz: So wie Wälder nach einem „Megafeuer“ aus tief liegenden Samen regenerieren, findet die Erzählerin durch die Akzeptanz der Krankheit ihrer Mutter und ihres eigenen Begehrens zu einem stabilen „Schwerpunkt“.
Joly schreibt: „Die Liebe ist ein Blitz, der dauert“ („L’amour est un éclair qui dure“).
Ernaux lehnt solche literarischen Ausschmückungen weitgehend ab. Ihre Poetik ist eine der „unmittelbaren Empfindung“. Metaphern werden meist vermieden, um die „inhumane“ Realität der Krankheit nicht zu beschönigen. Wenn sie Bilder verwendet, sind diese oft erschreckend physisch: Die Haut der Mutter ist „zerknittert wie die Unterseite von Pilzen“ („La peau de l’intérieur de ses bras froissée comme le dessous des champignons“). Das einzige große Bild ist das der „Nacht“, welches jedoch ein direktes Zitat der Mutter ist.
Fazit
Die Erzählhaltung bei Joly ist geprägt von „Luzidität und Humor“. Trotz des Schmerzes bewahrt die Erzählerin eine reflektierte Distanz, die es ihr erlaubt, die Krankheit der Mutter auch als Teil einer größeren menschlichen Erfahrung zu sehen. Sie sucht aktiv nach Sinn und Transformation: „Ich entscheide, dass ich wiederergrüne“ („Peut-être que je reverdis“). Die Erzählhaltung ist eine der Integration des Schmerzes in ein neues Leben.
Dans sa nouvelle chambre, alors que je m’apprêtais à partir en Bretagne, ma mère a prononcé une de ses phrases étranges et fulgurantes. Elle m’a dit, Pars, nous n’avons pas le même corps. Seul l’amour peut permettre ça, malgré la démence : le savoir de la phrase dont l’autre a précisément besoin. Je crois que ma mère sait qu’elle va mourir, que son corps va disparaître, et qu’elle me dit de vivre. Je me souviens de Lou et de ses années passées à l’hôpital, adolescente. Les filles ne peuvent pas être heureuses si elles portent le chagrin de leurs mères. (Joly)
In ihrem neuen Zimmer, als ich mich gerade auf den Weg in die Bretagne machen wollte, sagte meine Mutter einen ihrer seltsamen und eindringlichen Sätze. Sie sagte zu mir: Geh, wir haben nicht denselben Körper. Nur die Liebe kann das trotz Demenz ermöglichen: das Wissen um den Satz, den der andere gerade braucht. Ich glaube, meine Mutter weiß, dass sie sterben wird, dass ihr Körper verschwinden wird, und sie sagt mir, ich solle leben. Ich erinnere mich an Lou und ihre Jahre im Krankenhaus als Teenager. Mädchen können nicht glücklich sein, wenn sie die Trauer ihrer Mütter tragen.
Dies ist der Kulminationspunkt der Metamorphose der Tochter. Die Mutter schenkt der Tochter in einem Moment blitzartigen Bewusstseins die Erlaubnis zur Individuation. Der Satz „Wir haben nicht denselben Körper“ bricht die lebenslange symbiotische und schmerzhafte Verstrickung auf. Joly deutet Alzheimer hier fast mystisch: Die Krankheit filtert das Unwesentliche weg und lässt eine tiefe, mütterliche Weisheit zurück, die der Tochter ermöglicht, ihr eigenes Leben jenseits des Mitleids zu beginnen.
Ernaux hingegen schreibt aus einer Haltung der „Stupeur“ (Bestürzung) und des „Bouleversement“ (Erschütterung). Sie verweigert sich einer tröstlichen Synthese. Ihr Schreiben ist eine „Gewalt der Empfindungen“, die keine Ordnung sucht. Sie identifiziert sich so stark mit dem verfallenden Körper der Mutter, dass die Grenze zwischen „Ich“ und „Sie“ verschwimmt: „Dort zu sein, außer der Zeit […] ohne jeden Gedanken, außer: ‚das ist meine Mutter‘“ („…se tenir près d’elle, hors du temps […] de toute pensée, sauf : ‚c’est ma mère‘“).
So lässt sich sagen, dass Constance Joly Alzheimer literarisch einhegt, indem sie ihn mit den Metaphern des Wachstums und des Abenteuers (Alice) verwebt. Ihr Werk folgt einer Poetik der Resilienz. Annie Ernaux hingegen praktiziert eine Poetik der radikalen Präsenz, die das Unerträgliche ungeschönt stehen lässt. Während Joly zeigt, wie man durch den Verlust der Mutter zu sich selbst findet, zeigt Ernaux, wie man im Verlust der Mutter der nackten Wahrheit der menschlichen Existenz begegnet.
Der Vergleich der Romanschlüsse offenbart eine fundamentale Diskrepanz in der narrativen Bewältigung des mütterlichen Zerfalls: Während Jolys Werk in einer existentiellen Befreiung und dem symbolischen „Wiederergrünen“ mündet, dokumentiert Ernaux’ Text die ausweglose Endgültigkeit der Nacht. In „Reverdir“ fungiert die Demenz der Mutter am Ende als Katalysator für die Selbstwerdung der Tochter, die durch den mütterlichen Rat „Geh, wir haben nicht denselben Körper“ („Pars, nous n’avons pas le même corps“) ihre lebenslange Docilité (Fügsamkeit) ablegt. Joly nutzt die biologische Metaphorik, um die Katastrophe als einen Prozess der Regeneration zu deuten: Wie ein Wald, der nach einem Brand aus tiefen Wurzeln neu austreibt, findet die Erzählerin zu einer neuen „Wildheit“ (sauvagerie) und einem stabilen inneren Zentrum, das es ihr erlaubt, wie ein „Ballon ohne Bindung“ frei zu fliegen.
Im starken Gegensatz dazu verweigert Ernaux in Je ne suis pas sortie de ma nuit jede tröstliche Metamorphose und schließt mit der physischen Realität des Todes und einer tiefen Stupeur. Das Ende ist hier keine neue Blüte, sondern eine schmerzhafte Trennung, bei der das Bild der lebendigen Mutter und der Leichnam unverbunden nebeneinander stehen bleiben. Während Joly die Trümmer der Erinnerung nutzt, um eine neue Identität zu konstruieren, betrachtet Ernaux ihre Aufzeichnungen lediglich als den „Überrest eines Schmerzes“ („le résidu d’une douleur“), der das totale Versinken der Mutter in ihrer Dunkelheit festhält. Der Titel markiert dabei das endgültige Scheitern jeder Kommunikation: Das mütterliche Ich ist aus seiner Nacht nicht herausgekommen, und die Tochter bleibt als Chronistin dieses unwiderruflichen Verlusts zurück. Am Ende des Buches reflektiert Ernaux über die Unvereinbarkeit von Erinnerung und Realität. Die „Disjunktion“ (Trennung) beschreibt das Unvermögen, die kranke, lebendige Mutter mit der nun toten Mutter zu einer kohärenten Erzählung zu verschmelzen. Während Joly eine eigene Transformation findet, endet Ernaux bei der nackten Tatsache des Todes, die jede vorherige „Akzeptanz der Dekadenz“ hinfällig macht. Das Buch bleibt ein „Überrest eines Schmerzes“, der die Kluft zwischen dem Ich und dem verlorenen Anderen dokumentiert.
Il y a deux jours que je ne peux pas rassembler, celui qui était pareil à tous les dimanches où j’allais la voir, et le lundi, dernier jour, jour de sa mort. La vie, la mort demeurent de chaque côté de quelque chose, disjoints. Je suis dans la disjonction. Un jour, ce sera fini peut-être, tout sera lié, comme une histoire. Pour écrire, il faudrait que j’attende que ces deux jours soient fondus dans le reste de ma vie. Je sais que je suis dans cet état parce que depuis deux ans et demi – c’était le jour où je l’ai trouvée endormie – j’ai désiré qu’elle vive. Je l’ai acceptée comme elle était, dans sa déchéance. (Ernaux)
Seit zwei Tagen kann ich meine Gedanken nicht mehr ordnen, den Tag, der wie alle Sonntage war, an denen ich sie besuchte, und den Montag, den letzten Tag, den Tag ihres Todes. Leben und Tod bleiben auf beiden Seiten von etwas getrennt, unverbunden. Ich befinde mich in dieser Trennung. Eines Tages wird es vielleicht vorbei sein, alles wird miteinander verbunden sein, wie eine Geschichte. Um zu schreiben, müsste ich warten, bis diese beiden Tage mit dem Rest meines Lebens verschmolzen sind. Ich weiß, dass ich mich in diesem Zustand befinde, weil ich seit zweieinhalb Jahren – es war der Tag, an dem ich sie schlafend vorfand – den Wunsch hatte, dass sie leben möge. Ich habe sie so akzeptiert, wie sie war, in ihrem Verfall.