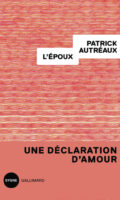Inhalt
La lézarde est un poste d’observation.
Hélène Frédérick, Lézardes
Der Textbruch ist ein Beobachtungsposten.
Setzfehler und Schreibprinzip
Das Bildfeld der „lézardes“ findet seinen Ursprung in der Fachsprache der Typografie, wo es die unschönen weißen Lücken bezeichnet, die durch das zufällige Aufeinandertreffen von Wortzwischenräumen im Satz entstehen. 1 Wenn das Lektorat von lézardes spricht, signalisiert es auch, es gibt einen Bruch im Textgefüge. Der Text hat zwar Substanz, benötigt aber eine Präzisierung, Straffung, Übergänge oder ähnliches. Es ist ein reparierbarer Mangel, eine Instabilität des Textes, es sind verdeckte Schwächen oder Inkonsistenzen: strukturell bspw. Brüche in der Argumentation, narrativ unmotivierte Wechsel etwa der Fokalisierung, stilistisch unmotivierte Registerwechsel oder Bildbrüche, semantisch z.B. uneinheitliche Verwendung von Begriffen. Bereits vor Öffnen des Buchs weckt der Titel also Erwartungen: an eine Handlung etwa, die weniger als lineare Ereignisabfolge denn als Serie von Spannungs- und Bruchstellen organisiert ist. Als Bewegung durch Texte, Beziehungen und berufliche Routinen, die äußerlich funktionieren, innerlich jedoch instabil sind. Die Arbeit des Lektors besteht darin, Risse in fremden Manuskripten zu identifizieren und zu „stabilisieren“, während sich möglicherweise parallel in ihrem eigenen Leben – emotional, biografisch, institutionell – ähnliche lézardes abzeichnen.
Das entspräche einer Logik der schleichenden Erosion: Nicht der Zusammenbruch stünde im Zentrum, sondern das langsame Sichtbarwerden von Unstimmigkeiten, Auslassungen und Verschiebungen, die weder eindeutig repariert noch endgültig entschieden werden. Poetisch würde sich der Roman dieser Thematik voraussichtlich anpassen, indem er selbst eine Ästhetik des Risses verfolgt: fragmentierte Szenen, elliptische Übergänge, bewusste Inkohärenzen und ein Vokabular, das aus dem Lektorat stammt (Randbemerkungen, Streichungen, Präzisierungen). Autopoetologisch könnte der Text damit seine eigene Herstellungsweise reflektieren: als Roman, der seine Brüche nicht kaschiert, sie vielmehr produktiv macht. Die Instanz des Lektors wird so ein Spiegel der Autorinstanz. Wenn ein Roman die These formulieren würde, dass Literatur nicht aus Glättung entsteht, im Gegenteil aus der Sichtbarmachung von Rissen – wäre letztlich der Leser in der Rolle des letzten Lektors, der zu entscheiden hätte, wie viel Fragilität ein Text aushalten kann.
Hybridität der Form
Hélène Frédéricks Lézardes (2025) ist ein hybrider Roman, der aus tagebuchartigen Miniaturen, autobiografisch grundierten Episoden, Essayfragmenten und poetischen Reflexionen besteht. Die Erzählerin – eine Autorin und Korrektorin in Paris – berichtet von ihrem gegenwärtigen Leben in der Redaktion eines Pariser Pressehauses, von der Arbeit in der Kabine der Korrektoren, dem sogenannten cassetin, und zugleich von der eigenen Herkunft in Montreal, einer Kindheit im Werkstattmilieu, dem Vater als „passeur“, einem Handwerker, der seine Tochter nicht nur in eine Ethik des Arbeitens, sondern auch in eine Poetik der Aufmerksamkeit einführt. Die Kapitel folgen keiner linearen Handlung, sie bilden eine mosaikartige Erkundung eines Berufs, einer Existenzweise und einer ästhetischen Haltung. Sie verbinden intime Selbstbeobachtung mit der Geschichte der Typographie und des Korrekturwesens, mit sozialhistorischen Reflexionen und mit der Frage, was es bedeutet, mit Sprache zu arbeiten – stets zwischen Fehler und Perfektion, zwischen Bewahren und Ausradieren.
Der Text enthält zahlreiche „Notizen aus dem Moment heraus“ („notes prises sur le vif“), die flüchtige Momente des Pariser Alltags oder des Arbeitslebens einfangen. Ein Beispiel hierfür ist das Festhalten von „Anomalien“ im Stadtbild, wie die schlafenden Enten auf dem Vorplatz der Nationalbibliothek oder der plötzliche Duft von Lavendel inmitten der Abgase an der Metrostation Olympiades. Diese Miniaturen dienen der Protagonistin als Atempausen in einer „gut geölten Maschine“ der modernen Welt. Auch die detaillierte Beschreibung der Geräuschkulisse im Korrekturbüro – das Klicken der Fingernägel auf der Tastatur oder das rhythmische Knarren der Terrassentür – wirkt ein Versuch, die Sinnlichkeit des scheinbar Unbedeutenden zu bewahren.
Zentral für die Struktur sind autobiographisch grundierte Rückblenden in die Kindheit der Autorin in Québec, insbesondere in die Werkstatt des Vaters. Diese Szenen sind präzise geschildert: Das Wickeln von Kupferdrähten im Wicklungskörper eines Motors wird als ein handwerkliches Modell für das spätere Schreiben und Korrigieren etabliert. Die Autobiografie und das Leben werden als eine „Existenz in Punkten“ („existence en pointillé“) begriffen, wobei die Erzählerin versucht, die verstreuten Fragmente ihrer eigenen Geschichte – von der Flucht aus der kanadischen Provinz bis zur Ankunft in Paris – wie Mosaiksteine zusammenzufügen. Der Wechsel zwischen dem adressierenden „Tu“ und dem persönlichen „Je“ verdeutlicht dabei die Spannung zwischen Selbstbeobachtung und Identität.
Kulturgeschichte des Korrekturwesens
Frédérick flicht essayistische Passagen ein, die sich mit der Kulturgeschichte des Korrekturwesens befassen. Sie zitiert historische Fachliteratur wie Eugène Boutmys Dictionnaire de l’argot des typographes (1883), um den Korrektor als einen „Transfuge“ zwischen Literatur und Handwerk zu definieren. Diese essayistischen Elemente weiten sich zu Porträts realer historischer Figuren aus dem anarchistischen Milieu aus, wie etwa Marius Jacob, Rirette Maîtrejean oder May Picqueray. Der Text dient hier als Archiv, das die Verbindung zwischen der „Polizei der Sprache“ (der Korrektur) und dem libertären Geist derer untersucht, die im Schatten der Druckereien arbeiteten.
Die Hybridität wird durch Reflexionen vervollständigt, die das Handwerkliche ins Philosophische heben. Die Sprache selbst wird als ein Gebilde beschrieben, das trotz seiner Risse unserem Dasein Form gibt. Die Erzählerin reflektiert über die Macht der Interpunktion – etwa die „velléités anarchistes“ (anarchistischen Tendenzen) ihrer Kommata – und begreift den Riss („la faille“) als die notwendige Bedingung für Poesie und das Überleben des Geistes.
Historisch war der Beruf des Korrektors direkt mit der physischen Druckerei verbunden: Das „cassetin“ war ursprünglich ein Fach im Setzkasten, während der „marbre“ (Marmor) jene steinerne oder gusseiserne Platte bezeichnete, auf der Texte umbrochen und korrigiert wurden. Das Korrekturwesen galt lange Zeit als eine Art „Aristokratie der Arbeiterwelt“, da oft ältere oder körperlich beeinträchtigte Typografen in diesen Bereich wechselten und sich durch den ständigen Kontakt mit Texten eine hohe Gelehrsamkeit aneigneten. Besonders in der Pariser Presse entwickelte sich eine starke historische Verbindung zu libertären und anarchistischen Milieus, wobei der Beruf als Refugium für Autodidakten, politische Flüchtlinge und gesellschaftliche Außenseiter diente. In der Gegenwart sieht sich dieses „Metier der Schatten“ jedoch durch wirtschaftliche Restrukturierungen, die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen und den Einsatz von Algorithmen in seiner Existenz bedroht. In diesen „Rissen der Welt“ finden Individuen wie May Picqueray oder Rirette Maîtrejean die Freiheit, sich fernab von gesellschaftlichen Konventionen selbst zu erfinden. Das Bildfeld der Risse symbolisiert somit eine bewusste Desertion aus den glatten, leistungsorientierten Strukturen der Moderne, um einen Raum für Bewegung, Eigensinn und die „ungeschriebene Geschichte“ zu bewahren: „… fernab vom Rampenlicht, im Gegensatz zu der selbstbeweihräuchernden Selbstdarstellung, die wir heute erleben: in den Rissen der Welt.“ 2
Dem Roman liegt eine zentrale Problemstellung zugrunde: Wie kann das Schreiben – und jene Nebenform des Schreibens, das Korrigieren – als Akt des Erhaltens von Welt verstanden werden, wenn die ökonomischen, sprachpolitischen und gesellschaftlichen Kräfte, die diese Welt strukturieren, auf Vereinheitlichung, Beschleunigung, Effizienz und das Verschwinden des Einzelnen abzielen? Lézardes stellt die Frage nach dem Wert eines Berufs, der per Definition unsichtbar bleiben muss, und zugleich die Frage nach der Autorschaft einer Person, deren Existenz zwischen verschiedenen Sprachen, Klassen, Ländern und Identitäten schwankt. Die „lézardes“ werden zur zentralen Metapher: Sie markieren die Stellen, an denen etwas brüchig wird, sich öffnet oder auseinanderfällt – und gerade deshalb sichtbar wird. Der Roman bewegt sich entlang dieser Bruchlinien und macht sie poetisch fruchtbar. Während die professionelle Korrektur danach strebt, Fantasien und vermeintliche Ungeschicklichkeiten zu glätten, kultiviert die Autorin eine Liebe für „wackelige Sätze“ (phrases bancales) und verabscheut das allzu Glatte. In diesem Sinne sind Risse im Text keine bloßen Fehler, vielmehr notwendige Räume für Poesie und Vorstellungskraft. Die Sprache selbst ist durch Inkonsistenzen und das Unvermögen, alles zu benennen, „rissig“, bildet aber gerade durch diese Unvollkommenheit das menschliche Leben ab: „Malgré sa difficulté à nommer, malgré tout ce qui la lézarde, elle donne forme à nos existences…“
Risse in der Familiengeschichte
In der persönlichen Biografie und dem Lebensweg der Protagonistin manifestieren sich die lézardes als Ausdruck tiefer Prekarität und existenzieller Brüche. Das Leben wird als eine Aneinanderreihung von „verstreuten Fragmenten“ und einer „vertrauten Unsicherheit“ geschildert, die bereits in der Familiengeschichte angelegt ist.
Un matin, en débarrassant pour tout remettre en place après avoir chassé la poussière de la surface du bureau, tu revois l’établi encombré d’outils de ton père. Le désordre, semblable au tien, n’y était qu’apparent. L’ordre obéissant à une logique invisible échappe au regard extérieur, à celui qui est seulement de passage. Chaque objet a sa place attitrée, son utilité, son histoire. Et les crayons sont tes outils. L’immobilité revenue, on trouvera des lézardes dans le solage de notre bungalow préfabriqué, pour nous rappeler la force obscure à laquelle nous devrions aller puiser, mais dont nous cherchons à oublier la présence.
Als du eines Morgens nach dem Staubwischen des Schreibtisches alles wieder an seinen Platz räumst, siehst du die mit Werkzeugen übersäte Werkbank deines Vaters. Die Unordnung, ähnlich wie deine eigene, war nur scheinbar. Die Ordnung, die einer unsichtbaren Logik folgt, entzieht sich dem Blick von außen, dem Blick desjenigen, der nur auf der Durchreise ist. Jeder Gegenstand hat seinen festen Platz, seinen Nutzen, seine Geschichte. Und die Stifte sind deine Werkzeuge. Wenn die Ruhe wiederkehrt, werden wir Risse im Fundament unseres Fertighauses finden, die uns an die dunkle Kraft erinnern, aus der wir schöpfen sollten, deren Existenz wir aber zu vergessen versuchen.
Ein zentrales Bild hierfür sind die tatsächlichen Risse im Fundament des elterlichen Bungalows, die nach einem Erdbeben sichtbar werden und an die „dunklen Kräfte“ erinnern, aus denen man schöpfen sollte, die man aber meist zu vergessen sucht. Diese Brüche im Leben werden jedoch nicht negativ bewertet; vielmehr wird die „faille“ (Spalte oder Kluft) als ein Zufluchtsort und eine Bedingung für das Überleben und das Schreiben begriffen: „Ich suche nach Rissen, in die ich mich verkriechen kann.“ 3
Riss und Romanstruktur
Der Text von Hélène Frédérick spiegelt das Motiv der lézardes unmittelbar in seiner eigenen Beschaffenheit wider, indem er eine fragmentierte Struktur wählt, die sich einer klassischen linearen Erzählweise entzieht. Anstatt eines geschlossenen Romans präsentiert sich das Werk als eine „poetische Untersuchung“, die aus Porträts, Erinnerungen und flüchtigen Notizen zusammengesetzt ist. Die Erzählweise ist dabei bewusst „oblique“ (schräg oder indirekt) und verwebt das Intime mit dem Kollektiven, wobei die Kapitel oft wie lose Bruchstücke wirken, die thematisch um Begriffe wie „Kalender“, „Magnet“ oder „Zweifel“ kreisen. Diese Struktur der verstreuten Fragmente korrespondiert mit der Darstellung einer „Existenz in Punkten“ („existence en pointillé“), die durch Brüche in der Biografie und geografische Verschiebungen zwischen Quebec und Paris geprägt ist.
Stilistisch und narrativ manifestieren sich die Risse in einem ständigen Perspektivwechsel, der die Distanz zwischen Selbstbeobachtung und Identität betont. Die Autorin nutzt häufig ein adressierendes „Du“, von dem sie selbst sagt, dass es ein „Ich“ nur mühsam camoufliert – wie der Schwanz einer Katze, die glaubt, unsichtbar zu sein. Diese sprachliche Aufspaltung zeigt einen Riss im Subjekt selbst. Zudem kultiviert der Text eine Ästhetik des Unvollkommenen: Er feiert „wackelige Sätze“ („phrases bancales“), das Stammeln („balbutiements“) und sogar Druckfehler („coquilles“), die als „notwendige Räume für die Vorstellungskraft“ begriffen werden. Der Text widersetzt sich damit dem „Glätten“ der Sprache, das die Protagonistin in ihrem Beruf als Korrektorin eigentlich leisten muss.
Die Ästhetik der wackeligen Sätze verkörpert im Roman einen bewussten Widerstand gegen das allzu Glatte und Normierte in Text und Leben. Während der Beruf der Korrektorin darauf abzielt, die Sprache zu „begradigen“ und sprachliche Fantasien als vermeintliche Unbeholfenheiten („maladresses“) zu tilgen, kultiviert die Protagonistin eine ausdrückliche Liebe zum Unvollkommenen, da sie im Glatten eine Form der Auslöschung von Poesie und Imagination sieht. Indem der Text die Schönheit in der Singularität und in Anomalien sucht, widersetzt er sich der „Polizei der Sprache“ und dem konservativen Akt des Korrigierens, der die Sprache vereinheitlichen will. Die phrases bancales fungieren somit als notwendige Zwischenräume oder Risse, die die Sprache „geschmeidig“ und „gastfreundlich“ („souple“, „hospitalière“) für die Brüche der menschlichen Erfahrung machen, anstatt sie in einer sterilen, marktkonformen Harmonie erstarren zu lassen.
Die Ästhetik des Stammelns wird im Roman als eine emanzipatorische und revolutionäre Kraft begriffen, die jenen eigen ist, deren Sprache „zwischen zwei Stühlen“ steht und die aus einer Position der materiellen oder sozialen Prekarität heraus sprechen. Anstatt das Stammeln als Defizit zu betrachten, das es im Sinne der professionellen Korrektur „geradezurücken“ gilt, feiert der Text es als Ausdruck einer inneren Dynamik („ruée intérieure“), die tief im Körper eingeschrieben ist und dazu dient, eine bisher namenlose Realität zu erschaffen. Diese Form der Artikulation widersetzt sich dem Glatten und Normierten, indem sie die Schönheit des Unvollkommenen – die „wackeligen Sätze“, die „Fantasien“ der Sprache und sogar Druckfehler – gegen die sterile Ordnung der „Polizei der Sprache“ verteidigt. Das Stammeln schafft somit eine notwendige Kluft, in der Poesie, Imagination und individueller Eigensinn überhaupt erst möglich werden, während das allzu Perfekte das Singuläre zu ersticken droht.
Diskrete Rebellion: Korrigieren als Gegenwelt
Au pays de l’exactitude, tu veux être une gigantesque coquille.
Im Land der Genauigkeit möchtest du ein gigantischer Druckfehler sein.
Hélène Frédéricks Roman inszeniert sich als poetische Selbstuntersuchung, die Autobiographie nicht als kohärente Lebensgeschichte erzählt, eher als eine Sammlung von Splittern. Jedes Kapitel wirkt wie ein „Riss“ im Bewusstsein oder in der Erinnerung, eine Art Fuge, durch die Licht einfällt. Die Erzählerin konfrontiert sich mit Herkunft, Beruf und den Spannungen zwischen ihrem kanadischen Hintergrund und dem französischen Sprachraum. Der Riss wird dabei weniger als Verletzung denn als Möglichkeitsraum dargestellt: ein Raum der Aufmerksamkeit, der Intensität, der Wahrnehmungssensibilisierung. Die „lézardes“ sind poetische Spuren des Unvollständigen – und im Gegensatz zur Logik der Korrektur, deren Aufgabe das „Glätten“ ist, schreibt der Roman die Unregelmäßigkeit als poetisches Prinzip fest.
So entsteht eine Dialektik: Die Erzählerin, deren Beruf das Ausradieren der Fehler ist, kultiviert zugleich eine Liebe zu den fehlerhaften, ungeraden, krummen Sätzen. Sie sucht nach den Stellen, an denen Sprache gegen sich selbst arbeitet; an denen sie stottert, vorstößt, stockt oder überläuft. Ihre inneren Risse – biografisch, sprachlich, sozial – werden so zum Motor ihrer Poetik.
Der Roman arbeitet an einem faszinierenden Spannungsfeld: Korrektoren müssen der Norm folgen, doch sie gehören historisch zu den libertären, anarchistischen Milieus. Sie sind Wächter der Sprache – und zugleich jene, die am meisten Gefühl für ihre Pluralität, ihre Ambiguität, ihre Unzumutbarkeit bewahren. Diese doppelte Bewegung – Bewahren und Ausradieren – bildet eines der zentralen Themen des Romans.
Die Arbeit im „cassetin“ wird dargestellt als Ort der Aufmerksamkeit, der Langsamkeit und der Präzision. In einer modernen Medienwelt, in der der Druck der Zeit steigt und in der immer weniger Menschen bereit sind, sich um sprachliche Details zu kümmern, wirken die Korrektoren wie Überreste einer vergangenen Epoche. Sie sind Hüter des Übergangs, letzte Verteidiger eines Handwerks, das wie das Werk des Vaters der Erzählerin aus der Zeit gefallen scheint.
Die Erzählerin begreift das Korrigieren als ethische Praxis: eine Praxis des Hinsehens, des Zweifels, des Infragestellens. Daran knüpft die poetologische Dimension des Romans: Der Zweifel wird zu einem Wert, der in der Gesellschaft missachtet, im Roman aber gefeiert wird. Die Korrektorin ist jene, die die Welt nicht selbstverständlich nimmt, die misstrauisch gegenüber der glatten Oberfläche bleibt und sich dem oberflächlichen Fortschrittsversprechen verweigert.
Werkstatt und Philologie
Die Rückblenden in die Werkstatt des Vaters schaffen eine zweite poetische Ebene. Der Vater repariert Maschinen, Wicklungen, Motoren – und die Erzählerin beobachtet mit kindlicher Faszination den Prozess des Wiederherstellens. Diese Szenen spiegeln den Korrekturberuf: Beide Tätigkeiten sind unsichtbare Reparaturen. Beide erfordern Präzision, Geduld, Hingabe. Und beide stehen im Widerspruch zu einer Welt, die lieber wegwirft als repariert. Das Atelier des Vaters, der Motoren repariert und seine Arbeit mit einem Poinçon signiert, wird zum Gegenbild des Pariser Korrekturbüros. In beiden Räumen wird sichtbar, wie sehr Handwerk und Philologie ineinander übergehen.
Der Text legt – oft implizit – die Bedingungen philologischer Arbeit frei: Zweifel, Nuance, Detailversessenheit, historische Sensibilität und die Liebe zur Materialität der Sprache. „Der gute Korrektor muss unaufhörlich zweifeln, selbst an dem, was er mit Sicherheit zu wissen glaubt.“ 4 Darin zeigt sich eine epistemologische Haltung, die für die Philologie zentral ist: Erkenntnis entsteht aus Skepsis. Der Korrektor ist philologischer Forscher – er interpretiert, befragt, vergleicht Textschichten und entscheidet über Varianten. Die Debatten über Kommata, über Anakoluthe, über typographische „marches“ besitzen dieselbe Struktur wie literaturwissenschaftliche Interpretationen.
J’aime voir mon père installer le fil de cuivre immaculé et brillant dans un stator ; il suit le schéma complexe qu’il a lui-même tracé au stylo sur du papier en défaisant les bobines cramées du moteur électrique à réparer pour les refaire à l’identique, taille du fil, nombre de tours de fil, taille des bobines, toutes numérotées. Son travail est soigné, reconnu dans toute la région et au-delà. Les fils de cuivre sont étincelants, encore plus qu’une chevelure de rêve, j’admire leur couleur chaude, j’aide à tailler les papiers spéciaux qui serviront à isoler les bobines les unes des autres. Ces papiers un peu fibreux varient en épaisseur, en couleur aussi, j’aime les toucher ; ils sont à la fois très résistants et doux, et leur rôle est essentiel. Sans leur protection, les charges négative et positive se rejoindraient et il y aurait court-circuit, m’explique-t-il. La notion de force semble entièrement contenue dans cette tension opposant négatif et positif, dans cette impossibilité parfaite que l’on exploite. C’est ainsi que, adolescente, j’interprète l’idée de puissance et son paradoxe.
Ich liebe es, meinem Vater dabei zuzusehen, wie er den makellosen, glänzenden Kupferdraht in einen Stator einbaut. Dabei folgt er dem komplexen Schema, das er selbst mit einem Stift auf Papier gezeichnet hat, indem er die verbrannten Spulen des zu reparierenden Elektromotors aufwickelt, um sie identisch nachzubauen – Drahtstärke, Anzahl der Drahtwindungen, Größe der Spulen, alles nummeriert. Seine Arbeit ist sorgfältig und in der ganzen Region und darüber hinaus anerkannt. Die Kupferdrähte glänzen, noch mehr als traumhaftes Haar, ich bewundere ihre warme Farbe, ich helfe dabei, das Spezialpapier zuzuschneiden, das dazu dient, die Spulen voneinander zu isolieren. Dieses etwas faserige Papier variiert in seiner Dicke und auch in seiner Farbe, ich berühre es gerne; es ist sowohl sehr widerstandsfähig als auch weich und spielt eine wesentliche Rolle. Ohne ihren Schutz würden sich die negativen und positiven Ladungen verbinden und es käme zu einem Kurzschluss, erklärt er mir. Der Begriff der Kraft scheint vollständig in dieser Spannung zwischen Negativ und Positiv enthalten zu sein, in dieser perfekten Unmöglichkeit, die wir ausnutzen. So interpretiere ich als Teenager die Idee der Macht und ihr Paradoxon.
Dieser Auszug zeigt die Werkstatt des Vaters als einen Ort der Präzision und der materiellen Poesie. Die Erzählerin beobachtet nicht nur ein Handwerk, sie lernt eine Grammatik der Wiederherstellung. Das „Refaire à l’identique“ (identische Wiederherstellen) antizipiert ihre spätere Arbeit als Korrektorin, bei der sie Texte in ihren Idealzustand zurückführt. Die Drähte und Papiere werden wie kostbare Schreibutensilien beschrieben, was verdeutlicht, dass die „Arbeit der Hände“ des Vaters die direkte Vorläuferin ihrer „Arbeit der Augen“ ist. Die Spannung zwischen den Polen im Motor wird zur Metapher für die Kraft, die auch in der Sprache durch Gegensätze und präzise Trennung entsteht.
Diese Werkstatt-Metaphorik ist zentral für die Poetik des Romans. Hier entsteht der Begriff einer „Arbeit der Hände“, die in die „Arbeit der Augen“ übergeht. Der Vater, der Kupferdrähte neu aufwickelt, ist das Modell für das spätere Schreiben und Korrigieren. Das Wiederherstellen des Alten wird zur Allegorie des Schreibens im Modus der Erinnerung. Und der Riss – die „lézarde“ – wird zum Ort der Reparatur, aber nicht im Sinne des Verschließens, vielmehr des Erkennens.
Un matin, en débarrassant pour tout remettre en place après avoir chassé la poussière de la surface du bureau, tu revois l’établi encombré d’outils de ton père. Le désordre, semblable au tien, n’y était qu’apparent. L’ordre obéissant à une logique invisible échappe au regard extérieur, à celui qui est seulement de passage. Chaque objet a sa place attitrée, son utilité, son histoire. Et les crayons sont tes outils. L’immobilité revenue, on trouvera des lézardes dans le solage de notre bungalow préfabriqué, pour nous rappeler la force obscure à laquelle nous devrions aller puiser, mais dont nous cherchons à oublier la présence.
Als du eines Morgens nach dem Staubwischen des Schreibtisches alles wieder an seinen Platz räumst, siehst du die mit Werkzeugen übersäte Werkbank deines Vaters. Die Unordnung, ähnlich wie bei dir, war nur scheinbar. Die Ordnung, die einer unsichtbaren Logik folgt, entzieht sich dem Blick von außen, dem Blick desjenigen, der nur auf der Durchreise ist. Jeder Gegenstand hat seinen festen Platz, seinen Nutzen, seine Geschichte. Und die Stifte sind deine Werkzeuge. Wenn die Ruhe wiederkehrt, werden wir Risse im Fundament unseres Fertighauses finden, die uns an die dunkle Kraft erinnern, aus der wir schöpfen sollten, deren Existenz wir aber zu vergessen versuchen.
In diesem Auszug verschmelzen die Räume endgültig: Der Schreibtisch der Autorin wird zur Werkbank („Etabli“). Die Werkzeug-Metaphorik (Stifte als Werkzeuge) unterstreicht den handwerklichen Charakter des Schreibens. Zentral ist hier das Bild der lézardes (Risse) im Fundament des Hauses. Diese Risse werden nicht als bloßer Schaden verstanden, den man zuspachteln muss, vielmehr als Zeichen einer „dunklen Kraft“. Die Reparatur, ob am Motor oder am Text, dient nicht dem reinen Verschluss, sie dient dem Erkennen der darunterliegenden Kräfte. Der Riss ist der Ort, an dem die Geschichte des Objekts oder des Lebens sichtbar wird, und die Arbeit der Erzählerin besteht darin, in diesen Zwischenräumen der Risse die Poesie der Wahrheit zu finden.
Korrekturarbeiten: Sprachreflexion und Erzählweise
Ein wichtiges Element der Reflexionen ist die sprachliche Doppelidentität der Erzählerin: zwischen Québec und Frankreich, zwischen mündlicher Alltagssprache und normiertem Redaktionsfranzösisch, zwischen poetischer Freiheit und orthographischer Norm. Diese Instabilität ermöglicht eine besonders feine Reflexion über Sprachpolitik, Klassensysteme und kulturelle Zugehörigkeit. Die Sprache wird nicht nur zum Medium, sondern zum Schauplatz von Konflikten.
Das Korrigieren ist hier nicht nur ein technischer, Korrigieren wird ein existenzieller Akt: Welche Sprache gehört mir? Welche Sprache darf ich korrigieren? Wie kann man schreiben, wenn man von einer Sprache geprägt ist, die immer schon moralisch und politisch aufgeladen ist? Der Roman zeigt, wie die Erzählerin sich inmitten dieser Konflikte positioniert, wie sie Normen akzeptiert, um sie zu verstehen, und zugleich unterläuft, um ihre eigene Stimme zu finden.
Strukturell ist Lézardes ein anti-narrativer Roman. Er verweigert die Einheit der Erzählung und setzt stattdessen auf eine Reihung von Miniaturen. Jede Szene ist eine poetische Verdichtung, oft knapp, fast lyrisch, bisweilen essayistisch. Die Erzählerin wechselt zwischen Erinnerung, Beobachtung, Reflexion und theoretischer Exkursion – doch der Text bleibt dabei stets rhythmisch, musikalisch, leicht.
Dieses Fragmentarische ist selbst ein Kommentar zur Korrekturarbeit: Auch dort werden Texte nicht als Ganzes erlebt, vielmehr als Aneinanderreihung von Details. Die Korrektorin liest „in Stücken“, und der Roman imitiert diese Lektüreform. Er macht den Leser selbst zum Korrektor, der die Brüche zusammensetzt, die Leerstellen füllt und Verbindungen herstellt. Die Erzählweise selbst vollzieht die poetics of the crack, die Ästhetik des Risses, ein Schreiben im Modus der Lücke.
Kommunikation im Roman ist reduziert, oft flüchtig. Es gibt die kurzen Gespräche im „cassetin“, die Interaktionen mit Journalistinnen, die seltsamen Begegnungen mit Figuren in der Stadt. Vieles wird nicht gesagt, manches nur angedeutet. Sprache erscheint als Medium der Verständigung und zugleich der Entfremdung. Die flüchtigen Bemerkungen von Kolleginnen, die scharfen Urteile, die kleinen Riten des Redaktionsalltags – all dies bildet ein kommunikatives Gewebe, in dem die Erzählerin zugleich Teil und Außenseiterin ist.
Zugleich zeigt der Roman, dass die intensivste Kommunikation nicht sprachlich ist: Sie liegt in den Gesten des Reparierens, des Zweifelns, des genauen Lesens. Korrektur ist eine Kommunikation mit dem Text – aber sie ist einseitig, stumm, unsichtbar, eine Form der Zuwendung ohne Gegenantwort. Diese einseitige Kommunikation trägt existenzielle Züge: Die Erzählerin ringt nicht mit Menschen, sondern mit Sprache selbst.
Der Roman entfaltet schließlich ein philosophisches Spannungsfeld, das seine ästhetische und thematische Grundspannung prägt: Bewahren und Ausradieren. Der Korrektor bewahrt den Text, indem er löscht. Er bewahrt die Sprache, indem er Varianten zerstört. Er bewahrt Bedeutung, indem er Ambiguität glättet. Diese paradoxale Tätigkeit wird im Roman als zutiefst menschliche Geste dargestellt: Jeder Mensch eliminiert, was nicht zu ihm passt, und versucht zugleich, Spuren zu erhalten, die ihm etwas bedeuten. Das Schreiben hingegen tut das Gegenteil: Es erzeugt Unordnung. Es schafft Risse, statt sie zu schließen. Der Roman macht deutlich, dass die Erzählerin genau an diesem Übergang lebt: zwischen der Ordnung des Korrektors und der Unordnung der Dichterin, zwischen Norm und Freiheit, zwischen Klarheit und Riss. Aus dieser Schwellenexistenz entsteht die Poetik von Lézardes.
Lézardes ist ein Roman über das Sehen, das Zweifeln, das Bewahren. Er ist ein literarisches Plädoyer gegen das Glatte, das Verkaufbare, das Effiziente, und ein poetisches Manifest für die Risse, die Unsauberkeiten, die Abweichungen. Der Roman zeigt, wie im unsichtbaren Beruf des Korrigierens eine Ethik und eine Ästhetik entstehen können, die dem Schreibenden wie dem Lesenden eine andere Art der Weltbeziehung eröffnen: In der Aufmerksamkeit für Details, im Respekt vor den Schwachen, im Festhalten an der Fragilität des Ausdrucks.
Insgesamt entwickelt sich der Text als poetische Initiationsgeschichte. Am Anfang steht Unsicherheit: berufliche Prekarität, Selbstzweifel, Angst vor dem Kontrollblick des Chefs, Sehnsucht nach poetischer Freiheit. In der Mitte entsteht ein allmähliches Bewusstsein dafür, dass die Tätigkeit des Korrigierens nicht Feindin der Poesie ist, sie ist ihr verborgenes Fundament. Die Geschichte des Vaters, des Autodidakten, der seine Arbeit signiert, wird zur Gegenfolie und zum Vorbild: Sprache ist ein Werkzeug wie ein Motor. Es ist nicht der Ursprung, es ist die Art der Arbeit, die ein Leben prägt. Am Ende erkennt die Erzählerin, dass der Riss nicht ein Fehler ist, sondern ein Ort der Erkenntnis. Die „lèzarde“ ist die ästhetische Wahrheit des Textes. Auch die Poetik verändert sich: Sie wird selbstbewusster, klarer im Wissen, dass Schreiben aus Reibung entsteht. Der Roman endet nicht mit einer Auflösung, eher mit einer Haltung: Das Bewahren des Risses wird zur Ethik.
Lézardes erweist sich als Roman über den Randbereich der Literatur: über die Arbeit hinter den Texten, über die Menschen, die den Raum zwischen Entwurf und Veröffentlichung bewohnen. Es ist ein Roman über Philologie, Literaturwissenschaft, Typographie, Arbeiterwissen und poetische Subjektivität zugleich. Indem er die Genealogie einer Schriftstellerin erzählt, zeigt er auch, dass Literatur aus Material, Handwerk, Geschichte und Rissen entsteht. Die Erzählerin lebt zwischen zwei Polen – zwischen Kanada und Frankreich, zwischen Werkstatt und Redaktion, zwischen Literatur und Journalismus, zwischen Freiheit und Regel. Doch aus dieser Zwischenexistenz entsteht eine außergewöhnliche literarische Stimme, die Risse nicht als bloße Brüche versteht, die zu glätten wären.
Anmerkungen- Die Erweiterung von Wortzwischenräumen innerhalb einer oder mehrere zusammenhängender Zeilen innerhalb einer Kolumne wird als „Austreiben“ oder „Ausbringen“ bezeichnet, das gleichmäßige Ausgleichen von Wortzwischenräumen innerhalb einer festgelegten Satzbreite als „Ausschließen“ oder „Ausrichten“. Die deutschen Setzer kennen über mehrere Zeilen auch Begriffe wie „Gasse“ oder „Gießbach“.>>>
- „…loin des projecteurs, à l’opposé du gargarisme autopromotionnel auquel on assiste aujourd’hui : dans les lézardes du monde.“>>>
- „Je cherche des lézardes dans lesquelles m’engouffrer.“>>>
- „Le bon correcteur… doit sans cesse douter, même de ce qu’il croit savoir avec certitude.“>>>