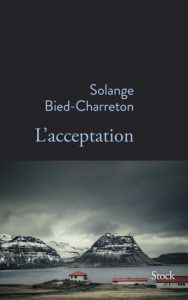Maintenant, ce qui frappe le plus, en remontant la rue des Couronnes, c’est sa césure, très nette. C’est sa séparation qui donne naissance à deux pays distincts. C’était là depuis le départ sans que j’y prête attention, déjà ça nous désignait. Ça survient juste après que la rue a croisé le tracé de la Petite Ceinture, l’ancienne ligne de train qui jadis effectuait le tour de Paris. La rue agrège des contrées étrangères l’une à l’autre avec une indifférence docile, une arrogance désintéressée. Comme c’est étrange, c’est devenu parfaitement anodin. Les deux mondes s’ignorent, nul ne semble en souffrir. C’est une nouvelle manière de vivre, séparément. On n’avait jamais vu cela avant.
Vivre-ensemble. Deux termes reliés d’un trait d’union venu souligner l’ironie du ratage d’une telle conjonction, deux termes ne se rendant aucun compte. La rue des Couronnes est l’une de ses antichambres les plus captivantes. C’est le laboratoire à ciel ouvert de la grande séparation. Dans la première moitié du paysage, il y a ces hauteurs, sévères et drues, grises et sans attrait qui partent du boulevard. C’est un relief récent, des cimes de béton sorties de terre. Un sol de bitume haché par des bandes de verdure. Une dalle de béton se propage autour de ces montagnes. Des bars à chicha aux noms américains et aux vitres fumées cadencent la monotonie à hauteur de trottoir. Les habitants sont de petites mains, des employés et quelques commerçants, des chômeurs, en provenance d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne. C’est une vie montagnarde, souvent rude, mais dotée de tout le confort moderne. Une contrée escarpée, un empilement méthodique d’humains et d’objets.
Du jardin des Couronnes à la place Henri-Krasucki, c’est en revanche un paysage d’avenues privées, d’immeubles de basse hauteur, de cours cachées, arborées, de lierre et de vigne vierge, de jardins même, où serpentent des lézards et clopinent des chats. Reliquat d’une époque lointaine, viticole, agricole ; d’un passé plus récent, d’ouvriers, d’ateliers. D’un hier noir et blanc, photographié par Willy Ronis. Un panorama tendre de vérandas fleuries au printemps, avec ses petites échoppes, étals de livres de poche, cantines de quartier. C’est un pays connu, reconnu, imité, et désormais recherché. En choisissant de camper dans ce décor de théâtre, des représentants de professions culturelles issus d’une ancienne classe moyenne depuis embourgeoisée s’achètent la possibilité, sur les pas de leurs aïeux, d’une bonne conscience.
Ce visage-là de la France des grandes villes, répartition ordonnée de bourgeois et d’immigrés pauvres, est devenue la norme. On n’a pu décemment établir de poste-frontière, mais l’on sait pourtant que ce qui s’y passe, notamment au niveau du croisement avec la rue Julien-Lacroix, revient exactement au même. Cette intersection marque le début d’un no man’s land, achevé aux alentours du bâtiment Troisième République de l’école maternelle (94, rue des Couronnes), où débute officiellement la seconde partie de la rue. Dans cet entre-deux, le contact visuel est inévitable. La terrasse du Tunis Palace, qui étend son empire de chaises en plastique vert pomme au numéro 41, fait face à celle du Floréal, au 43, établissement néo-rétro installé dans les murs de l’ancien café Dupont fondé en 1905. Une assemblée exclusivement masculine issue de l’immigration tunisienne buvant du thé et fumant la chicha fait face, chaque jour, à des bataillons mixtes de jeunes Occidentaux, entrepreneurs enrichis qui brunchent pour une trentaine d’euros chaque dimanche. Ce que cohabiter signifie : des mondes qui s’appréhendent dans une inexistence mutuelle, respectivement invisibles. Aucun briquet ne s’échange, aucun salut de la main. Il n’y a pas de correspondance à établir entre les clients, leurs centres d’intérêt, les prénoms de leurs enfants, leur manière de s’habiller, de manger ou de vivre. Je n’ai guère pu connaître l’époque des cabanes d’ouvriers à l’orée de la rue de la Mare, juste derrière Notre-Dame-de-la-Croix, au niveau de la passerelle piétonne – non loin de là se trouvait la gare Ménilmontant du train de Petite Ceinture ; celle des fenêtres murées rue de Pali-Kao, immeubles déglingués, étendoirs aux fenêtres, hordes d’enfants pouilleux et parapets en ruine ; l’époque des balustrades de la rue Vilin, rue à flanc de coteaux en forme de S inversé, devenue fantomatique au fil des années, rasée par les bulldozers en mars 1982, quelques semaines avant ma naissance. Je ne me souviens pas de l’époque du terrain vague. Je ne me souviens pas de ces escaliers en Y menant à la rue Piat. Comme beaucoup de mes semblables, je ne me souviens pas du Belleville de Georges Perec, de la devanture du salon du coiffure de sa mère, morte en déportation en 1943, dont la titraille (« Coiffure de dames ») s’est peu à peu estompée, avant d’être rasée. Je fais partie de la toute dernière vague d’arrivants. De ce fait, comme les chercheurs fous du parc de Fuglavík, je ne suis qu’une touriste du monde finissant et qui refuse de conférer à celui qui arrive, à ce schisme advenant sous mes yeux, une légitimité, une qualité propre, qui ne soit saturée de références au passé. Je n’ai pas le droit de me plaindre car je suis une aveugle, qui ne souffre jamais vraiment de cette sécession, tout y prenant part. Mes yeux sont emmurés comme l’étaient les fenêtres avant la destruction, à laquelle pourtant elles se préparaient.
Solange Bied-Charrenton, L’acceptation (Stock, 2023).
Nun, was am meisten auffällt, wenn man die Rue des Couronnes hinaufgeht, ist ihre Zäsur, die sehr deutlich ist. Es ist ihre Trennung, die zwei verschiedene Länder entstehen lässt. Es war von Anfang an da, ohne dass ich darauf geachtet hätte, es hat uns bereits bezeichnet. Es geschah, kurz nachdem die Straße den Verlauf des Petite Ceinture gekreuzt hatte, der alten Zuglinie, die einst um Paris herumführte. Die Straße aggregiert einander fremde Gegenden mit einer fügsamen Gleichgültigkeit, einer desinteressierten Arroganz. Wie seltsam, es ist vollkommen harmlos geworden. Die beiden Welten ignorieren einander, niemand scheint darunter zu leiden. Es ist eine neue Art, getrennt zu leben. Das hatten wir noch nie zuvor gesehen.
Zusammen-Leben. Zwei Begriffe, die mit einem Bindestrich verbunden sind, um die Ironie des Scheiterns einer solchen Verbindung zu unterstreichen, zwei Begriffe, die sich gegenseitig nicht wahrnehmen. Die Kronenstraße ist einer ihrer fesselndsten Vorräume. Sie ist das Freiluftlabor der großen Trennung. In der ersten Hälfte der Landschaft gibt es diese Höhen, streng und rau, grau und unattraktiv, die vom Boulevard ausgehen. Es handelt sich um ein neues Relief, aus der Erde gewachsene Betongipfel. Ein Asphaltboden, der von Grünstreifen zerhackt wird. Eine Betonplatte breitet sich um diese Berge herum aus. Shisha-Bars mit amerikanischen Namen und rauchigen Scheiben kadenzieren die Monotonie auf Gehsteighöhe. Die Bewohner sind kleine Arbeiter, Angestellte und einige Händler, Arbeitslose, die aus Nordafrika, aus Afrika südlich der Sahara kommen. Es ist ein Leben wie in den Bergen, oft hart, aber mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Ein steiles Land, ein methodisches Aufeinanderstapeln von Menschen und Gegenständen.
Vom Kronengarten bis zum Henri-Krasucki-Platz ist es dagegen eine Landschaft aus Privatstraßen, Flachbauten, versteckten Höfen mit Bäumen, Efeu und jungfräulichem Wein, sogar Gärten, in denen sich Eidechsen schlängeln und Katzen herumschleichen. Relikte aus einer fernen Epoche des Weinbaus und der Landwirtschaft; aus einer jüngeren Vergangenheit der Arbeiter und Werkstätten. Von einem schwarz-weißen Gestern, fotografiert von Willy Ronis. Ein zartes Panorama mit blühenden Veranden im Frühling, mit kleinen Läden, Ständen mit Taschenbüchern, Nachbarschaftskantinen. Es ist ein bekanntes, anerkanntes, imitiertes und nun gefragtes Land. Indem sie sich dafür entscheiden, in dieser Theaterkulisse zu kampieren, erkaufen sich Vertreter kultureller Berufe aus einer ehemaligen Mittelschicht, die inzwischen gentrifiziert ist, die Möglichkeit, in die Fußstapfen ihrer Vorfahren zu treten und ein gutes Gewissen zu haben.
Dieses Gesicht des Frankreichs in den Großstädten, eine geordnete Verteilung von Bourgeoisie und armen Einwanderern, ist zur Norm geworden. Es war nicht möglich, einen Grenzübergang einzurichten, aber man weiß, dass das, was dort passiert, insbesondere an der Kreuzung mit der Rue Julien-Lacroix, genau das Gleiche ist. Diese Kreuzung markiert den Beginn eines Niemandslandes, das um das Gebäude der Vorschule aus der Dritten Republik (94, rue des Couronnes) herum fertiggestellt wurde, wo der zweite Teil der Straße offiziell beginnt. In diesem Zwischenraum ist Augenkontakt unvermeidlich. Die Terrasse des Tunis Palace, das sein Reich aus apfelgrünen Plastikstühlen in der Nummer 41 ausbreitet, liegt gegenüber der Terrasse des Floréal in der Nummer 43, einem Neo-Retro-Lokal, das in den Mauern des ehemaligen, 1905 gegründeten Café Dupont untergebracht ist. Eine ausschließlich aus Männern mit tunesischem Migrationshintergrund bestehende, Tee trinkende und Shisha rauchende Versammlung steht jeden Tag gemischten Bataillonen von jungen Westlern gegenüber, wohlhabenden Unternehmern, die jeden Sonntag für etwa 30 Euro brunchen. Was zusammenleben bedeutet: Welten, die sich in gegenseitiger Nichtexistenz bzw. Unsichtbarkeit begreifen. Es werden keine Feuerzeuge ausgetauscht und keine Hände gegrüßt. Es gibt keine Übereinstimmungen zwischen den Kunden, ihren Interessen, den Vornamen ihrer Kinder, ihrer Art, sich zu kleiden, zu essen oder zu leben. Die Zeit der Arbeiterhütten am Rande der Rue de la Mare, gleich hinter Notre-Dame-de-la-Croix, auf der Höhe der Fußgängerbrücke – nicht weit davon entfernt befand sich der Bahnhof Ménilmontant des Petite-Ceinture-Zuges – konnte ich kaum kennenlernen; die Zeit der zugemauerten Fenster in der Rue de Pali-Kao, heruntergekommene Gebäude, Wäscheständer in den Fenstern, Horden verlauster Kinder und verfallene Brüstungen; die Zeit der Geländer in der Rue Vilin, einer Straße am Hang in Form eines umgekehrten S, die im Laufe der Jahre gespenstisch geworden war und im März 1982, wenige Wochen vor meiner Geburt, von Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ich kann mich nicht mehr an die Zeit des leeren Ödlands, terrain vague, erinnern. Ich erinnere mich nicht an die Y-Treppen, die zur Rue Piat führten. Wie viele meiner Mitmenschen erinnere ich mich nicht an das Belleville von Georges Perec, an die Schaufensterfront des Friseursalons seiner Mutter, die 1943 bei der Deportation starb und deren Titel („Coiffure de dames“) nach und nach verblasste, bevor er abgerissen wurde. Ich gehöre zu der allerletzten Welle von Ankömmlingen. Daher bin ich, wie die verrückten Forscher im Fuglavík-Park, nur eine Touristin der untergehenden Welt, die sich weigert, dem Kommenden, dem Schisma, das sich vor meinen Augen ereignet, eine Legitimität, eine eigene Qualität zu verleihen, die nicht mit Verweisen auf die Vergangenheit gesättigt ist. Ich habe kein Recht, mich zu beschweren, denn ich bin eine Blinde, die nie wirklich unter dieser Sezession leidet, da alles an ihr teilhat. Meine Augen sind eingemauert wie die Fenster vor der Zerstörung, auf die sie sich jedoch vorbereitet haben. 1
- „In einer Pariser Buchhandlung lernt die Französin Aurore den Isländer Gestur kennen. Ihre Liebe wird zwischen dem Fjord der Wale und den Straßen von Belleville, zwischen dem Versuch, ein Familienleben zu führen, und dem Erlöschen der Gefühle geknüpft und dann wieder ausgelöscht. Gestur, ein Archäologe, durchwühlt den von Salz und Lava verbrannten isländischen Boden auf der Suche nach Wikingergräbern. Aurora entdeckt kalte, stumme Landschaften von unerschütterlicher Pracht, die den Umbruch einer Gesellschaft, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte aus dem Mittelalter verabschiedet hat, am liebsten verbergen würden. Nach der Geburt ihres kleinen Sohnes Erling leben sie in der Zwischenwelt, weder Liebende noch Fremde, im Frankreich der Anschläge und dann der Gelbwesten, wo eine diffuse Elektrizität und Gewalt zirkuliert, die manche dazu veranlasst, zu sagen, dass man das Land nicht mehr wiedererkennt. So gewitterartig wie zärtlich, ist L’Acceptation eine Liebesgeschichte, die dazu auffordert, den Dingen ins Gesicht zu sehen. Von Aurore trassiert, zeichnet sich ein Weg durch Verleugnung und Angst, durch Melancholie und reine Freude ab, auf Kosten der Vorstellung, die sich jeder von seinem Land, seinem Platz und der Liebe macht.“ Übers. der Verlagsankündigung.>>>