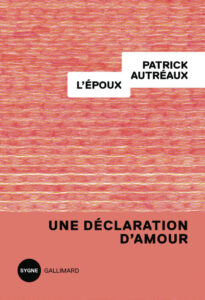Inhalt
…venus du désert comme on vient de l’au-delà de la mémoire.
Edmond Jabès
…aus der Wüste gekommen, wie man aus dem Jenseits der Erinnerung kommt.
Patrick Autréaux’ L’Époux (2025) ist ein leiser, existenziell verdichteter Roman, der von der standesamtlichen Trauung zweier Männer ausgeht. Ein Ritual, das als gesellschaftliche Anerkennung gedacht ist, wird zur Erfahrung radikaler Vereinzelung: durch die demonstrative Abwesenheit der Familien, die eine geografisch fern, die andere ideologisch und religiös sich verweigernd. Der Erzähler beobachtet die Tränen seines Partners; in diesem Moment brechen Jahre des Schweigens, der Anpassung und der erlittenen Zurückweisung auf. Ausgehend von diesem Moment entfaltet der Text eine vielschichtige Rückschau, in der sich eine homosexuelle Liebesgeschichte mit biografischen Verletzungen, Krankheit und einer tiefgreifenden spirituellen Suche verschränkt. Zentral ist dabei der jüdische Hintergrund der Familie des Partners, deren Geschichte von Shoah, Vertreibung und Exil geprägt ist und deren traumatische Erfahrung in eine religiöse Verhärtung und die Ablehnung der Beziehung mündet. Autréaux zeigt, wie diese kollektiven Wunden familiäre Bindungen vergiften und Schweigen, Tilgung und Ausschluss erzeugen. In der Auseinandersetzung mit dem Hohelied Salomos und dem Werk Edmond Jabès entwickelt der Roman eine Poetik der Abwesenheit, des Schweigens und des Exils, in der der Körper des Geliebten zum Ort des Heiligen wird. L’Époux liest sich so als modernes Hohelied, das die intime Geschichte einer homosexuellen Liebe mit der Last jüdischer Erinnerung verbindet und eine fragile, aber beharrliche Transzendenz entwirft – „aus der Wüste gekommen, wie man aus dem Jenseits der Erinnerung kommt“.
Die standesamtliche Trauung ist hierbei die einzige klar datierbare Gegenwartsszene des Romans. Ihre Nüchternheit kontrastiert mit der emotionalen Wucht, die sie für das Paar entfaltet. Die Abwesenheit der Familien ist dabei mehr als ein soziales Detail: Sie markiert eine Leerstelle, die religiös, kulturell und genealogisch aufgeladen ist. In der jüdisch-christlichen Tradition ist die Ehe ein öffentliches, gemeinschaftlich beglaubigtes Bündnis. Hier jedoch bleibt sie ohne Zeugen. Die Liebe steht buchstäblich ohne Überlieferung da. Die Tränen des Partners sind nicht allein Ausdruck persönlicher Kränkung, sondern Verdichtung einer historischen Erfahrung homosexueller Liebe: geliebt zu haben ohne Anerkennung, gelebt zu haben ohne Segen. Die Trauung wird damit zum paradoxen Moment, in dem Intimität und Öffentlichkeit nicht zusammenfinden. Ausgehend von diesem Punkt verzweigt sich der Roman in mehrere ineinander verschränkte Erzählstränge.
Biographischer Erzählstrang
In L’époux werden drei wesentliche Dimensionen menschlicher Erfahrung zu einer dichten, polyphonen Erzählung verwoben, die über eine bloße Liebesgeschichte hinausgeht. Die Tränen des Bräutigams während der Zeremonie lösen beim Ich-Erzähler jahrelang unterdrückter Erinnerungen aus und das Bedürfnis, das „Schweigen der Jahre“ schreibend zu durchbrechen. Von diesem Fixpunkt aus entfaltet der biografische Strang eine schonungslose Analyse der Vergangenheit. Der Erzähler blickt zurück auf eine frühere, toxische Beziehung zu einem Liebhaber, den er „Casanova“ nennt. Diese Liaison war geprägt von Gewalt, Nihilismus und einer oberflächlichen Gier, die der Erzähler im Rückblick als einen „zweiten Verlust der Jungfräulichkeit“ beschreibt, da sie seine „verzauberte Einsamkeit“ und seinen inneren Dialog zerstörte. Parallel dazu beleuchtet der Roman tief sitzende Verletzungen aus dem „Scheidungskrieg“ seiner Eltern, in dem der Erzähler schon früh die Rolle eines „gebastelten Therapeuten“ übernehmen musste. Besonders prägend ist die Erkenntnis der mangelnden väterlichen Liebe; sein Vater gestand ihm einst, dass er als Kind nicht gewünscht war, was das Gefühl einer existenziellen Wurzellosigkeit verstärkte.
Ein zentraler Pfeiler dieser Biografie ist die Überwindung einer schweren Krebserkrankung mit dreißig Jahren. Die Erfahrung der Chemotherapie, die das Paar bereits Jahre zuvor während einer zivilen Partnerschaft in New York gemeinsam durchstand, markiert den Körper des Erzählers dauerhaft als einen Ort der Zerbrechlichkeit und der Heilung zugleich. Das Schreiben wird in diesem Kontext zu einem Akt des Überlebens, der über die bloße medizinische Genesung hinausgeht. Der Körper wird im Roman nicht anatomisch, sondern poetisch katalogisiert: Der Erzähler beschreibt die Narben und das Altern nicht als Makel, sie sind vielmehr Zeugnisse einer geteilten Geschichte.
Inmitten dieser Trümmer der Vergangenheit steht die Liebesgeschichte als eine langsame, fast meditative Annäherung zweier Männer. Ihre Dynamik ist von einer eigentümlichen Balance aus intensiver körperlicher Präsenz und einem respektvollen, „wortkargen Schweigen“ geprägt. Der Partner, dessen Name im Text nie genannt wird, gewährt dem Erzähler eine unerschütterliche Verankerung und einen „Heimathafen“ („port d’attache“). Autréaux sakralisiert diese Beziehung in Form eines modernen Hohelieds, indem er die Liebe in all ihren Phasen feiert: von der jugendlichen Ungeduld über die Fieberschübe der Krankheit bis hin zur Akzeptanz des alternden Körpers. Diese bedingungslose Zuneigung ermöglicht es dem Erzähler, das Gefühl des „Unendlichen“ zu bewahren, auch wenn er den traditionellen Glauben an Gott verloren hat.
Der erzählerische Bogen spannt sich dabei geografisch weit auf, von den ersten Begegnungen in Paris über Reisen nach Israel und Spanien bis hin zum gemeinsamen Exil in den USA. In New York wird das Paar Zeuge des Einsturzes der Twin Towers, ein Ereignis, das die historische Fragilität der Welt spiegelt und die persönliche Suche nach Frieden in einer instabilen Moderne unterstreicht. Die Liebe zwischen dem christlich geprägten Erzähler und seinem jüdischen Partner wird so zu einem „Ort der Versöhnung“ unterschiedlicher Kulturen und Traumata, der dem „Nichts“ der Welt eine menschliche Wärme entgegensetzt.
Familiär-religiöser Erzählstrang
J’aurai beau faire et dire : je ne serai jamais de la famille. Alors je continue à lire, non plus pour m’approcher de toi ou des tiens, mais pour comprendre ce que je vis – pour éprouver cette exclusion sans m’arrêter au ressentiment qu’elle fait grandir, à la colère sourde qui va et vient. Me tremper dans la vie des autres et chercher ce que je reconnais de leur exclusion. C’est de cette façon-là que je veux devenir juif. Avec Bashevis Singer, j’entre dans des villages disparus où l’on est triste et chantant, où l’on joue du violon et se balance sur des toits, où l’on danse et marche dans la boue.
Ich kann tun und sagen, was ich will: Ich werde niemals zur Familie gehören. Also lese ich weiter, nicht mehr, um dir oder deinen Angehörigen näher zu kommen, sondern um zu verstehen, was ich erlebe – um diese Ausgrenzung zu spüren, ohne mich von dem Groll, den sie hervorruft, und der dumpfen Wut, die kommt und geht, aufhalten zu lassen. Ich tauche ein in das Leben anderer und suche nach dem, was ich an ihrer Ausgrenzung wiedererkenne. Auf diese Weise möchte ich Jude werden. Mit Bashevis Singer betrete ich verschwundene Dörfer, in denen man traurig ist und singt, in denen man Geige spielt und auf Dächern schaukelt, in denen man tanzt und durch den Schlamm läuft.
Hier wird die Literatur zur Brücke über den Abgrund der familiären Ablehnung. Da der Erzähler aufgrund seiner Herkunft und Identität niemals voll in die Familie seines Partners integriert werden wird, wählt er den Weg der intellektuellen und emotionalen Wahlverwandtschaft. Er „wird jüdisch“, indem er die Erfahrung des Ausgeschlossenseins und des Exils durch die Lektüre jüdischer Autoren (wie Singer oder Roth) teilt. Das Lesen ist somit kein passiver Zeitvertreib, es ist eine aktive spirituelle Übung in Empathie und Gerechtigkeit.
Der familiär-religiöse Erzählstrang in Patrick Autréaux’ Roman „L’époux“ entfaltet sich als eine schmerzhafte Chronik der Ablehnung, die als jahrelanger „kalter Krieg“ zwischen dem Paar und den jüdischen Eltern des Partners beschrieben wird. Dieser Konflikt nahm seinen Anfang vor fünfzehn Jahren mit dem Coming-out des Sohnes in Paris – einem Moment, der die Eltern in eine tiefe Identitätskrise stürzte und eine Abfolge von Leugnung, Unverständnis und Verurteilung auslöste. Für die Eltern, deren Familiengeschichte durch traumatische Erfahrungen wie die Shoah und die Vertreibung aus Ägypten geprägt ist, stellt die Homosexualität des Sohnes sowie seine Verbindung zu einem Nicht-Juden einen unannehmbaren Bruch mit der Tradition dar.
Besonders die Mutter des Partners reagiert auf die empfundene Schande mit einer Radikalisierung ihrer religiösen Praxis. Diese neu gefundene Frömmigkeit wird im Roman als „saurer Verband“ („pansement acide“) charakterisiert – eine bittere Form des spirituellen Trostes, die nicht der Heilung dient, vielmehr dazu genutzt wird, die homosexuelle Identität ihres Sohnes als fundamentales Versagen gegenüber der Tora zu brandmarken. In ihrer Logik ist die Katastrophe der „Abweichung“ ihres Sohnes eine Folge mangelnder Bibeltreue, weshalb sie Zuflucht bei strengen Rabbinern sucht und versucht, das „Problem“ durch eine verstärkte Einhaltung jüdischer Riten zu sühnen.
Diese systematische Ablehnung äußert sich in einer grausamen symbolischen Tilgung des Erzählers aus dem kollektiven Familiengedächtnis: Der Name des Erzählers wird in Gesprächen fast nie ausgesprochen; er wird zum „Skandalbringer“ und zum „Gespenst“ degradiert, das im Haus der Eltern keinen Platz hat. Der Erzähler wird konsequent aus Familienfotos ferngehalten oder sogar nachträglich aus dem bildlichen Gedächtnis „ausradiert“, sodass er im Bewusstsein der Verwandten als faktisch nicht existent behandelt wird. In einem Akt fast ritueller Reinigung entfernt die Mutter alle Werke aus ihrer Bibliothek, die nicht von jüdischen Künstlern stammen oder sich nicht explizit mit jüdischen Themen befassen, einschließlich Büchern über den interreligiösen Dialog.
Diese jahrelange Strategie des Verschweigens und des „Runterschluckens“ von Ungesagtem („ravaler les non-dits“) findet ihren emotionalen Höhepunkt in der demonstrativen Abwesenheit der Eltern bei der standesamtlichen Trauung. Während die Standesbeamtin feierlich von der Aufnahme in den Kreis der Familien spricht, wird die tatsächliche Isolation des Paares durch die leeren Stühle im Saal schmerzhaft sichtbar. Erst durch die Vermittlung einer weisen Tante, die strategisch andere queere Familienmitglieder („Sodom und Gomorra“) offenbart, gelingt es dem Erzähler schließlich, seinen Groll zu zügeln und die Ablehnung als Teil einer komplexen, verwundeten Familiengeschichte zu begreifen, die er durch das Schreiben zu heilen versucht.
Das Schweigen in L’Époux ist nicht bloß Ausdruck von Sprachlosigkeit, es ist auch eine bewusste ethische Haltung. Autréaux entwickelt eine Poetik, in der Schweigen als Schutzraum der Beziehung wirkt. Besonders in Szenen körperlicher Nähe wird deutlich, dass Worte als Eingriff empfunden werden könnten – als Versuch, das Unverfügbare festzulegen. Das Schweigen des Partners ist dabei von besonderer Bedeutung. Es verweist auf eine Geschichte des Überlebens, auf generationsübergreifende Erfahrungen von Verfolgung, Verlust und Diskretion. Der Erzähler lernt, dieses Schweigen nicht zu interpretieren oder zu füllen, vielmehr es als solches zu respektieren.
Poetologisch entspricht dieses Schweigen der Textstruktur selbst: kurze Absätze, elliptische Übergänge, semantische Leerstellen. Autréaux schreibt nicht gegen das Schweigen an, er schreibt mit dem Schweigen. Der Text bewahrt Zonen der Unbestimmtheit, in denen sich Leserinnen und Leser verweilen können.
Intellektuelle und spirituelle Suchbewegung
Die intellektuelle und spirituelle Odyssee des Erzählers in L’époux stellt als weiterer Erzählstrang eine radikale Suchbewegung dar, die über den Verlust des traditionellen christlichen Glaubens hinausführt und in einer tiefen Annäherung an das jüdische Denken und dessen Literatur mündet. Getrieben von der zentralen Frage, wie man das Gefühl des Unendlichen bewahren kann, ohne an einen dogmatischen Gott zu glauben, nutzt der Protagonist die biblische Archäologie und die Evolutionsbiologie als Werkzeuge der intellektuellen Immunisierung gegen religiöse Verbote. Indem er die Bibel durch wissenschaftliche Erkenntnisse als ein von Menschenhand geschaffenes, heterogenes „Mosaik“ aus Legenden und Fragmenten entlarvt, befreit er sich von der moralischen Last des Dogmas und verlagert das Gefühl des Heiligen in die Immanenz der menschlichen Verbindung und den „Heimathafen“ der Ehe.
Dieser intertextuelle Diskurs, der den Roman als einen poetisch-theologischen Reflexionsraum strukturiert, findet seine Verankerung insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem Werk von Edmond Jabès und mit dem biblischen Hohelied. Jabès’ „Buch der Fragen“ bildet dabei einen „Nabel der Liebe“ und ein Portal zum Judentum, das es dem Erzähler ermöglicht, die Leere nicht als Bedrohung, sondern als Raum der Freiheit und der „wissenden Ignoranz“ zu begreifen. In der Verschränkung von sinnlicher Lobpreisung des Geliebten – die das Werk als ein „neues Hohelied“ kennzeichnet – und der intellektuellen Dekonstruktion religiöser Teleologie entwirft Autréaux eine moderne Form der Spiritualität, in der das Schreiben selbst zum Akt des Überlebens und zur einzig möglichen Form der Erlösung wird.
Blaise Pascal und seine Pensées bilden im Roman einen zentralen philosophischen Ankerpunkt, der die existentielle Angst und die spirituelle Leere des Erzählers strukturiert. Besonders das berühmte Zitat über das „ewige Schweigen dieser unendlichen Räume“ zieht sich als Leitmotiv durch das Buch und spiegelt die Erschütterung des Erzählers wider, der versucht, ein Gefühl des Unendlichen zu bewahren, während er den traditionellen Glauben verliert. Die im Roman mehrfach erwähnte Anekdote von Pascal, der zeitlebens einen Abgrund („gouffre“) zu seiner Linken sah und einen Stuhl davorstellte, um sich zu vergewissern, wird zur zentralen Metapher für den Umgang des Protagonisten mit seinen eigenen suizidalen Krisen und der metaphysischen Bodenlosigkeit. Pascal wird dabei nicht als Tröster begriffen, er ist ein „unbeugsamer, zweifelnder Geist“ und „Freund“ in der Dunkelheit, der den Schmerz des Menschseins nicht durch Dogmen lindert, vielmehr durch das Aushalten von Paradoxien und eine „unversöhnliche Wachsamkeit“ bewohnbar macht. In der Verbindung zu Pascals „Mysterium Jesu“ findet der Erzähler eine Rechtfertigung für seine eigene rastlose Suche: Die Vorstellung, dass die Agonie der Welt bis zum Ende der Zeiten andauert und man währenddessen nicht schlafen darf, übersetzt er in seine poetische Praxis der Aufmerksamkeit gegenüber der Zerbrechlichkeit des Lebens und des Geliebten.
Narrative Struktur
Diese Stränge sind nicht linear angeordnet. Autréaux wählt eine assoziative, zyklische Erzählweise, in der Gegenwart und Vergangenheit, Erinnerung und Lektüre, Körpererfahrung und Textlektüre ineinander übergehen. Die Zeit des Romans ist weniger chronologisch als existenziell organisiert: Sie folgt den Bewegungen von Nähe und Entfernung, von Sprechen und Schweigen.
Die narrative Struktur von L’Époux ist als Bewegungsraum konzipiert, in dem sich Erinnerung, Gegenwart und Lektüre permanent überlagern. Die Hochzeit bildet einen Fixpunkt, von dem aus der Erzähler rückwärts und seitwärts erzählt. Diese Struktur lässt sich als palimpsestartig beschreiben: Frühere Liebeserfahrungen, Kindheitserinnerungen, Krankheitsepisoden und Leseszenen schieben sich übereinander. Zeit erscheint nicht als Abfolge, sie erscheint als Verdichtung. Besonders auffällig ist, dass zentrale Ereignisse – das Kennenlernen, erste Berührungen, Trennungen – nicht in dramatischer Zuspitzung, sondern in tastenden, fragmentierten Bildern erzählt werden. Diese Erzählweise korrespondiert mit der thematischen Konzentration auf Schweigen und Abwesenheit. Die Zeit des Romans ist eine Zeit der Unterbrechungen. Pausen, Leerstellen und Ellipsen strukturieren den Text stärker als Handlungsketten. Autréaux inszeniert damit eine Poetik der Diskontinuität, die der Erfahrung homosexueller Existenz in einer nicht anerkennenden Gesellschaft entspricht.
Zentral für L’Époux ist das Spannungsverhältnis von Sprache und Schweigen. Der Erzähler reflektiert immer wieder die Unzulänglichkeit der Sprache, wenn es darum geht, Liebe, Körper und Glaubensverlust auszudrücken. Besonders in der Beziehung zum Partner wird Schweigen zu einer eigenständigen Kommunikationsform. Konkrete Szenen – gemeinsames Liegen im Dunkeln, wortlose Berührungen, Blicke – zeigen, dass Intimität jenseits des Gesagten entsteht. Sprache erscheint häufig als gefährlich: Sie kann verletzen, fixieren, verraten. Schweigen hingegen bewahrt Offenheit. Diese Poetik verweigert sich der narrativen Transparenz und insistiert auf der Unverfügbarkeit des Anderen.
Hohelied-Metaphorik: Körper, Stimme, Abwesenheit
Tu auras été amant, ami, frère et époux. Tu as aimé mon corps de jeunesse, son avidité et son impatience ; tu as aimé mon corps malade, autre fièvre ; tu as aimé un corps balafré et lui as murmuré : Tu es beau ; tu as aimé un corps qui t’a délaissé et est revenu vers toi ; tu aimes un corps vieillissant. Je pourrais longuement parler de tes yeux et tes lèvres, d’un grain de beauté sur ton bras, des veines de tes mains, de ton ventre qui respire, des chuchotements le soir et aussi de ce pincement qui étranglait tes larmes quand tu as cru que j’allais te quitter pour un autre. Je pourrais parler de ton sourire et de tes paupières quand tu dors. J’aime les lettres de ton nom.
Du warst Liebhaber, Freund, Bruder und Ehemann. Du hast meinen jugendlichen Körper geliebt, seine Gier und Ungeduld; du hast meinen kranken Körper geliebt, ein anderes Fieber; du hast einen entstellten Körper geliebt und ihm zugeflüstert: Du bist schön; du hast einen Körper geliebt, der dich verlassen hat und zu dir zurückgekehrt ist; du liebst einen alternden Körper. Ich könnte lange über deine Augen und deine Lippen sprechen, über ein Muttermal auf deinem Arm, über die Adern deiner Hände, über deinen atmenden Bauch, über das Flüstern am Abend und auch über das Zwicken, das deine Tränen erstickte, als du glaubtest, ich würde dich für einen anderen verlassen. Ich könnte über dein Lächeln und deine Augenlider sprechen, wenn du schläfst. Ich liebe die Buchstaben deines Namens.
Das Hohelied Salomos bildet in Patrick Autréaux’ L’époux die zentrale intertextuelle Matrix, die weit über bloße Zitate hinausgeht und den gesamten Roman als ein „neues Hohelied“ strukturiert. In einer Welt, in der religiöse Dogmen – insbesondere die strafenden Verse des Levitikus – oft dazu genutzt werden, homosexuelle Liebe als „Gräuel“ zu brandmarken und gesellschaftlich wie familiär auszugrenzen, bietet dieser biblische Text Autréaux ein kraftvolles Gegenmodell. Das Hohelied feiert die Liebe in einer zutiefst sinnlichen Bildsprache, die auf moralische Normierungen verzichtet und stattdessen die unmittelbare menschliche Verbindung sakralisiert. Indem der Erzähler seine Beziehung in diese Tradition stellt, entzieht er sie der kirchlichen Verurteilung und verleiht ihr einen Rang des Heiligen, der nicht von göttlichen Geboten abhängt, vielmehr von der Intensität des Erlebens.
Wie im biblischen Vorbild wird der Körper des Geliebten in L’époux in fragmentierten, fast ekstatischen Bildern beschrieben, die eine tiefe, allumfassende Zuneigung widerspiegeln. Der Erzähler katalogisiert den Körper seines Partners nicht in einem anatomischen oder klinischen Sinne, obwohl er selbst einen medizinischen Hintergrund hat, sondern in einem rein poetischen Akt der Lobpreisung. Er verweilt bei den Augen, den Lippen, einem Muttermal auf dem Arm, den Venen der Hände und dem atmenden Bauch seines Mannes. Diese Körperpoetik ist dabei niemals pornografisch, sondern spirituell-sakralisierend: Der Körper wird zum Ort der Offenbarung. Besonders eindringlich wird dies in der bedingungslosen Annahme aller körperlichen Zustände deutlich: Der Erzähler feiert den jugendlichen Körper in seiner Gier ebenso wie den durch Krankheit gezeichneten, den vernarbten und schließlich den alternden Körper. Jede Falte und jede Narbe wird als Teil einer „visuellen und mystischen Evidenz“ begriffen, die das Unendliche im Fleisch verortet.
Innerhalb dieser Metaphorik spielt die Stimme eine zentrale, wenngleich paradoxe Rolle. Während im biblischen Hohelied die Stimme des Geliebten die Liebende herbeiruft und Sehnsucht entfacht, ist sie in „L’époux“ oft durch Abwesenheit oder extreme Knappheit gekennzeichnet. Der Partner wird als ein wortkarger und schweigsamer Mensch beschrieben, dessen Kommunikation sich häufig in der Stille vollzieht. Seine Stimme erscheint als ein seltenes, fast kostbares Ereignis, was ihre Bedeutung ins Unermessliche steigert. Der Erzähler lernt, dieses Schweigen zu „lesen“ und die „muetten Suppliken“ in den Buchstaben des Namens seines Geliebten zu hören. Die Stimme wird so zum Zeichen einer absoluten Gegenwart, die keine vielen Worte braucht, um eine „ruhige Weisheit“ und tiefe Verbundenheit zu vermitteln. In den „Chuchotements“ (Flüstern) am Abend findet der Erzähler jene sakrale Qualität, die er in den lauten, oft heuchlerischen religiösen Institutionen vermisst.
Die Abwesenheit schließlich ist das verbindende Motiv, das das Hohelied und den Roman unauflöslich miteinander verknüpft. Wie die Liebenden im Hohelied einander in den Straßen suchen und oft verfehlen, so bewegt sich auch „L’époux“ ständig im Spannungsfeld zwischen intimer Nähe und schmerzhaftem Verlust. Diese Abwesenheit manifestiert sich auf mehreren Ebenen: in der physischen Abwesenheit der Familien am Tag der Hochzeit, die das Paar in eine schmerzhafte Isolation stürzt, und in der theologischen Suche nach einem Gott, der sich entzogen hat. Autréaux schreibt ein Hohelied der Abwesenheit, in dem die Liebe nicht als Besitz, sondern als eine andauernde spirituelle Reise und Sehnsucht definiert wird. Der Partner bietet in der Leere des „Nichts“ Halt, ohne die existenzielle Unsicherheit jemals ganz aufzuheben. So wird die Liebe zu einer Form einer „auf Unwissen gründenden Frömmigkeit“, die das Unendliche gerade dort findet, wo alle Gewissheiten schwinden.
Edmond Jabès: Buch, Wüste, Name Gottes
Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk des jüdisch-ägyptischen Dichters Edmond Jabès markiert in Patrick Autréaux’ Roman L’époux den entscheidenden Wendepunkt der inneren, spirituellen Bewegung. Jabès wirkt hier als eine fundamentale Denkfigur, die dem Erzähler den „Nabel seiner Liebe“ und zugleich das Portal in die jüdische Welt seines Partners eröffnet. Jabès’ Denken ist zutiefst geprägt von den Motiven des Exils, des Buches und der Gottesabwesenheit; für ihn ist Gott kein sprechendes, autoritäres Subjekt, sondern eine produktive Leerstelle im Text. Diese Vorstellung eines Gottes, der sich in den Rückzug („Tsimtsoum“) begeben hat, um Raum für die Welt und das menschliche Wort zu schaffen, ermöglicht es dem Erzähler, Spiritualität neu zu definieren: als eine Form des „wissenden Unwissens“, die das Unendliche gerade dort spürt, wo die dogmatischen Sicherheiten enden.
In dieser Logik wird das Buch bei Jabès – und folglich auch in Autréaux’ Roman – zum eigentlichen Ort der Gottesfrage. Da es keine religiöse Institution mehr gibt, der der Erzähler vertrauen könnte, wirkt das Lesen selbst als spirituelle Praxis. Der Erzähler liest nicht, um zu glauben oder sich einer fertigen Wahrheit zu unterwerfen, sondern um zu verstehen und die „Blöcke des Schweigens“ zu durchdringen, die zwischen ihm, seinem Partner und dessen Herkunft liegen. Das Buch ersetzt die religiöse Institution und wird zum „einzigen möglichen Heil“, das die Erfahrung des Abgrunds nicht zudeckt, sondern bewohnbar macht. Diese Praxis des Lesens ist „par et pour toi“ (durch und für dich) motiviert; sie ist ein Akt der Liebe, der versucht, die kulturellen und historischen Wunden des anderen – wie die Shoah oder die Vertreibung aus Ägypten – schreibend und lesend nachzuvollziehen.
Die Wüste, ein zentrales Motiv im Werk von Jabès, erscheint in L’époux als ein radikaler innerer Zustand der Entblößung. Sie steht für die existenzielle Erfahrung, ohne den Schutzwall religiöser oder familiärer Gewissheiten zu leben. Diese metaphorische Wüste findet ihr Echo in den emotionalen Räumen des Romans: in der „guerre froide“ (kalten Krieg) der familiären Ablehnung durch die Schwiegereltern, im Verlust des christlichen Kinderglaubens und in der Einsamkeit einer homosexuellen Liebe, die sich oft in einer „erlittenen Diskretion“ behaupten muss. Die Wüste ist der Ort, an dem der Erzähler dem „Zéro“ begegnet – jenem vertiginalen Punkt des Nichts, den er bereits als Schüler an der Schultafel erlebte und der nun zum Ausgangspunkt einer Poesie wird, die keine Erlösung verspricht, sondern absolute Aufmerksamkeit verlangt.
Der Name Gottes schließlich bleibt bei Jabès, ganz in der jüdischen Tradition, unaussprechlich. Auch Autréaux verweigert im Roman eine theologische Fixierung oder Benennung des Göttlichen; an die Stelle des sakralen Tetragramms tritt jedoch die poetische Anrufung des Geliebten. Obwohl der Name des Ehemanns im Text niemals explizit genannt wird, betont der Erzähler ekstatisch: „J’aime les lettres de ton nom“ (Ich liebe die Buchstaben deines Namens). Der Name wird somit nicht als Besitz ergriffen, sondern als ein fragiles, inebrennbares Geheimnis verehrt, das „voll von muetten Suppliken“ ist. Die Liebe wird hier zur Praxis einer Benennung ohne Besitz: Der Geliebte entzieht sich der vollständigen Verfügbarkeit, genau wie der abwesende Gott Jabès’. In diesem Respekt vor dem Unnennbaren findet der Erzähler jene „transzendente Immanenz“, die es ihm erlaubt, das Unendliche im alternden, vernarbten Fleisch des Partners zu verorten, anstatt in einem fernen Himmel.
Exil und Zugehörigkeit
Der Holocaust bildet in den Quellen den traumatischen Hintergrund der jüdischen Familiengeschichte des Partners, dessen Vorfahren wie die Urgroßeltern in Theresienstadt interniert und schließlich in Auschwitz ermordet wurden. Um diese historische Wunde und die daraus resultierende religiöse Unbeugsamkeit der Schwiegereltern zu verstehen, nutzt der Erzähler eine dichte intertextuelle Strategie und vertieft sich in eine regelrechte „Bibliothek der Katastrophe“. Er greift dabei auf zentrale Werke und Zeugnisse der Shoah zurück, wie Paul Celans Todesfuge, Victor Klemperers LTI sowie die erschütternden Dokumente von Adam Czerniaków, Emanuel Ringelblum und Zalmen Gradowski. Diese literarische Auseinandersetzung, die auch Autoren wie Joseph Roth, Aharon Appelfeld und Philip Roth umfasst, dient dem Erzähler als eine Art „spirituelle Immunisierung“; sie ermöglicht es ihm, seinen Groll gegen die Ablehnung durch die Eltern abzubauen, indem er die Erfahrung des Ausgeschlossenseins und der Resilienz als geteiltes Erbe begreift. Letztlich eröffnet die Beschäftigung mit diesen Texten für den Protagonisten als ein Weg, sich die Geschichte des jüdischen Volkes schreibend zu erschließen und die Liebe zu seinem Partner durch das Verständnis für dessen traumatische Herkunft zu vertiefen.
Das Motiv des Exils bildet einen der tragenden Bedeutungshorizonte von L’Époux und verbindet biografische, religiöse und poetische Ebenen miteinander. Exil ist dabei nicht nur als historisch-jüdische Erfahrung präsent, Exil ist die existenzielle Grundfigur moderner Subjektivität. Der Partner des Erzählers steht genealogisch in einer jüdischen Tradition, die Exil nicht als Ausnahme, vielmehr als Normalzustand denkt. Zugehörigkeit ist hier nie selbstverständlich, sie ist immer prekär, vermittelt durch Texte, Rituale, Namen. Diese Form der Zugehörigkeit ist nicht territorial, sie ist textuell und erinnerungsgebunden. Der Erzähler nähert sich dieser Perspektive nicht durch Konversion, sondern durch ein tastendes Verstehen, das Lesen, Schweigen und Respekt einschließt.
Parallel dazu erfährt der Erzähler selbst ein spirituelles Exil. Der Verlust des christlichen Glaubens bedeutet keinen triumphalen Bruch, er bedeutet einen schmerzhaften Entzug von Sinn, Sprache und Gemeinschaft. Dieses Exil ist kein freiwilliger Zustand, vielmehr das Resultat einer Entfremdung, die sich langsam vollzogen hat. Der Erzähler bleibt religiös sensibel, aber ohne institutionelle Heimat.
Die homosexuelle Beziehung wird vor diesem Hintergrund zu einem dritten Exilraum: gesellschaftlich nicht vollständig integriert, familiär nicht anerkannt, religiös nicht legitimiert. Doch gerade diese dreifache Randständigkeit erzeugt eine besondere Form der Nähe. Die Beziehung wird zur geteilten Erfahrung des Nicht-Dazugehörens. Zugehörigkeit entsteht nicht durch Anerkennung von außen, sondern durch das gemeinsame Aushalten von Fragilität.
Unsicherheit und Befreiung
Sous mes yeux, la Bible entière s’était métamorphosée en une mosaïque dont l’hétérogénéité dépassait ce que j’avais su jusqu’alors. Et si cet essai n’entamait pas l’édifice moral de ce monument, il lui ôtait toute prétention à la justification des batailles du temps présent, et le replaçait dans la bibliothèque des livres saints de l’humanité, où un peuple avait dû trouver un sens en survivant au gré des contrecoups de l’Histoire. Quant à l’Être suprême dont il était question, il se réduisait à un grand trou sonore : les Écritures n’en disaient rien de moins contestable que n’importe quelle lignée de poètes angoissés. Et c’est ainsi que, comme le prophète ayant vu la gloire de l’Éternel quitter le temple avec ses anges, je sentis son esprit s’échapper comme un gaz de l’ampoule brisée qu’était devenue la Bible à mes yeux. Plus que le livre saint, c’est une galaxie religieuse en moi qui avait éclaté.
Vor meinen Augen hatte sich die gesamte Bibel in ein Mosaik verwandelt, dessen Heterogenität alles übertraf, was ich bis dahin gekannt hatte. Und wenn dieser Versuch auch nicht das moralische Fundament dieses Monuments erschütterte, so entzog er ihm doch jeden Anspruch auf Rechtfertigung der Kämpfe der Gegenwart und stellte es wieder in die Bibliothek der heiligen Bücher der Menschheit, wo ein Volk einen Sinn gefunden haben musste, indem es die Rückschläge der Geschichte überlebte. Was das höchste Wesen betraf, von dem die Rede war, so reduzierte es sich auf ein großes, hallendes Loch: Die Schriften sagten nicht weniger Umstrittenes darüber aus als jede Reihe von angstvollen Dichtern. Und so spürte ich, wie der Prophet, der die Herrlichkeit des Ewigen mit seinen Engeln den Tempel verlassen sah, wie sein Geist wie Gas aus der zerbrochenen Glühbirne entwich, zu der die Bibel in meinen Augen geworden war. Mehr als das heilige Buch war eine religiöse Galaxie in mir zerbrochen.
Die Lektüre archäologischer Studien über das alte Israel wirkt auf den Erzähler wie eine „Illumination“. Indem er die Bibel als ein von Menschenhand geschaffenes Mosaik erkennt, verliert sie für ihn ihren dogmatischen Schrecken. Diese Dekonstruktion ist eine Befreiung: Sie „immunisiert“ ihn gegen die religiös begründete Homophobie der Schwiegereltern. Gott wird zu einem „großen klangvollen Loch“, was den Weg ebnet für eine Spiritualität, die das Unendliche nicht in Schriften, vielmehr in der menschlichen Resilienz sucht.
Der Romanschluss von L’époux führt die biografischen, familiären und spirituellen Fäden des Werkes in einer finalen Synthese zusammen, die das Motiv der „Unsicherheit“ als befreienden Seinszustand etabliert. Während die Reise durch die Negev-Wüste und der erschütternde Ohnmachtsanfall des Partners die physische Hinfälligkeit und die „ontologische Verwundung“ durch die jahrelange familiäre Ablehnung erneut schmerzhaft vor Augen führen, transformiert der Erzähler diese Erfahrung in einen spirituellen Sieg: Er erkennt, dass das „Fast-Nichts Gottes“ kein Abgrund der Leere ist, es ist ein nicht versiegender Raum der Möglichkeiten. Die Konfrontation mit der Nichte Noa über die systematische Tilgung des Erzählers aus den Familienfotos dient dabei als kathartischer Moment, in dem das jahrelange Schweigen der Wahrheit über die Liebe weicht und der Erzähler lernt, das Leiden des Partners ohne Groll als Teil einer größeren, verwundeten Geschichte zu akzeptieren.
Je n’en attendais plus de révélation, ni d’adoubement qui me dirait Je suis content de toi, ni un au-delà et pas même une frontière, mais un espace qu’aucun opercule ne bouche, qu’aucune fin ne fait atteindre, et où on entend courir encore la meute chasseresse du poète. […] Ce soir-là, elle insisterait pour que ce soit moi qui lise la prière et fasse les bénédictions – Baruch atah Adonai. Et ça ferait bien rire les tourtereaux, car je prononce la langue de Dieu sans la comprendre et comme si je mâchais des pierres.
Ich erwartete keine Offenbarung mehr, keinen Ritterschlag, der mir sagen würde: Ich bin zufrieden mit dir, kein Jenseits und nicht einmal eine Grenze, sondern einen Raum, den kein Verschluss verschließt, den kein Ende erreicht und in dem man noch immer die jagende Meute des Dichters laufen hört. […] An diesem Abend würde sie darauf bestehen, dass ich das Gebet lese und den Segen spreche – Baruch atah Adonai. Und das würde die Turteltauben zum Lachen bringen, denn ich spreche die Sprache Gottes, ohne sie zu verstehen, und als würde ich auf Steinen herumkauen.
Die abschließende Szene eines Schabbat-Abends in Eilat, in der der Erzähler die hebräischen Segenssprüche spricht, markiert den Höhepunkt seiner Suche nach einer „Transzendenz in der Immanenz“. Obwohl er die „Sprache Gottes“ nicht vollständig versteht und das Gefühl hat, beim Aussprechen der fremden Laute symbolisch „Steine zu kauen“, wird dieser rituelle Akt zur ultimativen Liebeserklärung und zum Zeichen einer tiefen Verbundenheit, die jenseits von Dogmen und formaler Konversion besteht.
Das Schlussbild der „jagenden Meute des Dichters“, ein Verweis auf die Nobelpreisrede von Saint-John Perse, steht in Patrick Autréaux’ Roman als kraftvolle Metapher für eine Spiritualität, die sich jeder statischen Ankunft verweigert. Anstatt die Suche nach dem Unendlichen mit einer religiösen Gewissheit oder einem dogmatischen Abschluss zu krönen, bleibt die Bewegung des Erzählers ein rastloses Weiterrennen im offenen Raum der Möglichkeiten. Diese „Meute“ symbolisiert das Schreiben selbst, das für den Erzähler eine Funktion übernimmt, die früher der Religion vorbehalten war: Es ist der einzige Weg, der als Ersatz für den religiösen Pfad dienen kann und vielleicht die einzig mögliche Form der Erlösung darstellt. Das Ziel dieser Jagd ist jedoch kein ferner Gott, sondern die unaufhörliche Praxis der Aufmerksamkeit gegenüber dem Partner. Da der Erzähler die Bibel durch wissenschaftliche und archäologische Studien als ein von Menschenhand geschaffenes „Mosaik“ dekonstruiert hat, findet er das Heilige nicht mehr in heiligen Schriften, er findet es in der Immanenz des menschlichen Körpers.
Die religiöse Gewissheit wird durch ein „wissendes Unwissen“ ersetzt, die das Unendliche gerade im „Nichts“ oder im Abgrund der existenziellen Unsicherheit verortet. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf das profane Fleisch des Geliebten, das der Erzähler in allen Stadien – vom jugendlichen Begehren über die Narben der Krebserkrankung bis hin zum Altern – wie in einem „neuen Hohelied“ sakralisiert. Die Liebe wird somit zu einer visuellen und mystischen Evidenz, die keinen transzendenten Gott braucht, vielmehr ihre Heiligkeit aus der täglichen, zärtlichen Zuwendung und dem „wortkargen Schweigen“ des anderen bezieht.
Am Ende des Romans, während des Schabbat-Abends in Eilat, wird deutlich, dass das Aussprechen der hebräischen Segenssprüche kein Akt des religiösen Glaubens im traditionellen Sinne ist. Es ist vielmehr ein ritueller Ausdruck dieser poetischen Praxis: Ein Bekenntnis zur „Unfassbarkeit auf menschlicher Augenhöhe“, bei der die Suche niemals endet, die in der ständigen Bewegung der „Meute“ – dem fortwährenden Schreiben und Lieben – ihren eigentlichen Sinn findet.