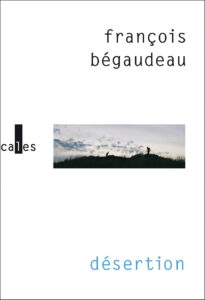Dieser Beitrag ist auf Deutsch verfasst. Automatische Übersetzungen:
Inhalt
Radikalisierung ohne lineare Erklärung
François Bégaudeaus Roman Désertion (2026) erzählt die Geschichte eines Verschwindens, das lange vor der eigentlichen Abreise beginnt. Steve wächst in einer französischen Küstenstadt auf, besucht die Schule, schaut Fernsehen, lebt in einer intakten, unauffälligen Familie – und fällt dennoch zunehmend aus allen Bindungen heraus. Der Roman folgt ihm durch Schuljahre, Freundschaften, erste Demütigungen, körperliche Veränderungen und mediale Obsessionen, ohne je einen dramatischen Wendepunkt zu markieren. Stattdessen häufen sich kleine Verschiebungen: Steve wird stiller, abwesender, unsichtbarer; Gespräche versanden, Zugehörigkeiten lösen sich auf, die Tage verlieren ihr Profil. Während die Institutionen korrekt funktionieren und die Familie wohlmeinend bleibt, findet Steve keinen Ort mehr, an dem seine Erfahrungen Bedeutung haben. Parallel dazu öffnen Medien und virtuelle Räume eine Welt klarer Rollen und eindeutiger Ordnungen. Am Ende steht keine Explosion, kein Skandal, sondern eine leise, irreversible Bewegung: Steve verlässt Frankreich und schließt sich in Raqqa dem Dschihad an. Bégaudeau erzählt diesen Weg ohne Sensation und ohne Erklärung – als eine folgerichtige, beunruhigende Konsequenz eines Lebens, das nirgends mehr gesehen wurde.
Désertion entzieht sich von Beginn an einer linearen Erklärung. Zwar ist der äußere Fluchtpunkt des Textes klar benannt – der Weg Steves von einer französischen Küstenstadt bis nach Raqqa –, doch der Roman verweigert sich jeder kausalen Erzählung im Sinne einer Radikalisierungsbiografie. Stattdessen entwirft Bégaudeau eine Poetik der Verzettelung, der Verschiebung und der Parallelisierung, in der das Spektakuläre stets aus dem Banalen hervorgeht und das Politische aus dem scheinbar Unpolitischen. Désertion ist ein Roman über soziale Unsichtbarkeit, über kommunikative Fehlstellen und über eine Gesellschaft, die ihre Abweichungen systematisch produziert, ohne sie wahrnehmen zu wollen.
Der Roman setzt nicht bei einem traumatischen Einschnitt oder einer ideologischen Initialzündung an, sondern bei einem kulturell saturierten, medial hochaufgeladenen Moment: der zweiten Staffel der Star Academy, wenige Wochen nach dem 11. September 2001. Diese Koinzidenz ist programmatisch. Bégaudeau konfrontiert zwei Formen globaler Ereignishaftigkeit – den Terroranschlag und das Fernsehformat – ohne sie explizit zu verbinden. Der Text insistiert darauf, dass sich das Leben Steves nicht entlang der großen politischen Marker organisiert, sondern entlang jener Mikroereignisse, die das Subjekt affektiv binden: Fernsehbilder, Popidole, familiäre Rituale, Schulalltag.
Die erzählte Lebensgeschichte Steves entfaltet sich lose chronologisch, immer wieder unterbrochen von Exkursen, Einschüben, Abschweifungen. Diese Struktur ist nicht bloß mimetisch – sie bildet nicht nur die Zerstreuung eines jugendlichen Bewusstseins ab –, sondern epistemologisch: Sie verweigert dem Leser jene klare Rückschau, die Radikalisierung gewöhnlich als logische Folge erscheinen lässt. Stattdessen entsteht ein Narrativ der Nicht-Notwendigkeit: Nichts musste so kommen, und gerade deshalb konnte es so kommen.
Brüder, Spiegelungen, Asymmetrien
Im Zentrum des Romans steht die Beziehung zwischen Steve und seinem jüngeren Bruder Mickaël. Bégaudeau inszeniert sie als ein Verhältnis minimaler Differenz: „tout est dans le presque“. Die Brüder teilen Herkunft, Milieu, Erfahrungen – und doch entwickeln sie sich auseinander. Mickaël ist der Robustere, der Ironischere, der Sozialkompetentere; Steve der Sensiblere, der Angepasste, der permanent Suchende. Diese Konstellation ist entscheidend, weil sie jede monokausale Erklärung unterläuft: Steve ist nicht „der Benachteiligte“, nicht der sozial Abgehängte im klassischen Sinn. Seine Desintegration ist subtiler, leiser, weniger sichtbar.
Nebenfiguren – Eltern, Lehrkräfte, Mitschüler – erscheinen weniger als individuelle Charaktere denn als Träger institutioneller Sprechweisen. Besonders die Schule agiert als zentraler Resonanzraum: nicht als Ort expliziter Gewalt, vielmehr als Maschine der Klassifikation, der Bewertung und der Normalisierung. Steve fällt nicht durch spektakuläre Abweichung auf, er zeigt Überangepasstheit durch höfliche Unsichtbarkeit. Darin liegt wohl seine Gefährdung.
Ein zentrales Thema des Romans ist das Misslingen von Kommunikation. Gespräche finden statt, aber sie führen ins Leere; Fragen werden gestellt, aber nicht wirklich gehört. Steve ist jemand, der antwortet, wenn eine Antwort erwartet wird, der spricht, ohne sich mitzuteilen. Seine Sprache ist korrekt, funktional, unauffällig – und gerade deshalb wirkungslos.
Demgegenüber stehen andere Kommunikationsformen: Fernsehen, Computerspiele, SMS, später ideologische Texte und Bilder. Sie alle zeichnen sich durch eine Asymmetrie aus: Sie verlangen keine Antwort, sondern Zustimmung, Wiederholung, Nachvollzug. Bégaudeau wertet diese Medien nicht moralisch ab; er zeigt vielmehr, dass sie dort Anschluss bieten, wo die face-to-face-Kommunikation versagt. Radikalisierung erscheint so nicht als Verführung durch Inhalte, sondern als Ersatz für Beziehung.
Chronische Gegenwart, Krieg, Spiel, Leere
Die Zeit in Désertion ist keine dramatische Zeit. Es gibt keine plötzlichen Brüche, keine dramatischen Wendepunkte. Stattdessen arbeitet der Roman mit einer Akkumulation minimaler Kränkungen, mit dem, was man als „chronische Gegenwart“ bezeichnen könnte. Die Jahre vergehen, ohne dass sich Entscheidendes ereignet – und genau darin liegt das Entscheidende.
Bégaudeau macht erfahrbar, dass Gewalt nicht nur eruptiv, sondern auch sedimentär sein kann. Der Text insistiert auf Wiederholung: Schulwege, Unterrichtsstunden, familiäre Wochenenden. Diese Wiederholung erzeugt keine Stabilität, sondern Erosion. Steve wird nicht vertrieben, er wird vergessen.
Die Metaphorik von Désertion arbeitet nicht mit opulenten Bildern oder symbolischen Verdichtungen im klassischen Sinn, sondern mit einer bewusst reduzierten, funktionalen Bildsprache, deren Präzision sich erst im Close Reading erschließt. Bégaudeau setzt Metaphern nicht als poetische Überhöhung ein, vielmehr als Wahrnehmungsraster. Besonders deutlich wird dies in der wiederkehrenden Verschränkung von Spiel- und Kriegssemantik, etwa wenn Computerspiele wie Battlefield beschrieben werden. Diese Szenen sind auffällig nüchtern gehalten: keine moralische Alarmierung, keine psychologisierende Überzeichnung. Stattdessen konzentriert sich der Text auf die Struktur der Erfahrung. Der virtuelle Raum ist kartiert, gegliedert, überschaubar; Bewegungen haben Richtung, Handlungen Konsequenzen, Erfolge sind sichtbar. Begriffe wie Ziel, Mission, Gegner oder Level wirken weniger als konkrete Metaphern denn als kognitive Kategorien, die Steves Wahrnehmung ordnen. Entscheidend ist dabei nicht der Inhalt des Spiels – also Gewalt oder Militär –, sondern die Tatsache, dass das Spiel eine Welt anbietet, in der Sinn unmittelbar aus Handlung resultiert. Bégaudeau vermeidet damit jede simple Kausalbehauptung im Sinne von „Spiele machen gewalttätig“; vielmehr zeigt er, wie sie eine Form von Weltverhältnis modellieren, die im Alltag fehlt.
Dieser modellierten Ordnung steht die auffällige Bildarmut der Alltagsräume gegenüber. Klassenräume, Bushaltestellen, Wohnräume werden wiederholt beschrieben, aber kaum sinnhaft aufgeladen. Sie erscheinen als funktionale Durchgangszonen, als Orte ohne Ereignisdichte. Im Klassenzimmer gibt es Sitzordnungen, Stundenpläne, Regeln – aber keine Richtung. Die Bushaltestelle ist ein Ort des Wartens ohne Erwartung, der Wohnraum ein Raum des Nebeneinanders ohne Verdichtung. Bégaudeau beschreibt diese Orte in einer Sprache der Neutralität, fast der Leere. Gerade dadurch wird ihre metaphorische Funktion sichtbar: Sie stehen für eine Welt, in der Bewegung nicht auf ein Ziel hin organisiert ist, sondern sich erschöpft. Das Subjekt ist hier präsent, aber nicht engagiert; es nimmt teil, ohne beteiligt zu sein.
Vor diesem Hintergrund erscheint der Krieg im Roman nicht als radikaler Gegenentwurf zum Alltag, sondern als dessen Überformung. Die Kriegssemantik übernimmt jene Funktionen, die der zivile Alltag nicht mehr erfüllt: klare Grenzziehungen, eindeutige Zugehörigkeiten, sichtbare Wirkungen von Handlungen. Während der Alltag Steves Erfahrungen neutralisiert – jede Geste versandet, jede Äußerung wird registriert und vergessen –, verspricht der Krieg eine Verdichtung von Bedeutung. Handeln zählt, Opfer zählen, Positionen sind markiert. Der Krieg ist damit keine fremde, von außen eindringende Realität, sondern eine symbolische Ordnung, die dort Anschluss findet, wo der Alltag indifferent geworden ist.
Bégaudeaus Metaphorik ist deshalb politisch so wirksam, weil sie auf Dramatisierung verzichtet. Der Übergang vom Spiel zur Ideologie, vom virtuellen Kampf zur realen Gewalt, wird nicht als Bruch inszeniert, sondern als Verschiebung derselben Logik in einen anderen Kontext. Der Roman legt nahe, dass nicht Gewalt an sich verführerisch ist, sondern Sinn. In einer Welt, in der der Alltag keine lesbaren Zeichen mehr hervorbringt, wird der Krieg zur extremen, aber kohärenten Semantik. Die Metaphern des Romans benennen diesen Zusammenhang nicht explizit; sie lassen ihn entstehen, indem sie Ordnung und Leere, Regelhaftigkeit und Indifferenz gegeneinander ausspielen. Gerade in dieser Zurückhaltung liegt ihre analytische Schärfe.
Republik ohne Resonanz
Désertion ist ein französischer Roman nicht, weil er nationale Identität affirmiert, vielmehr weil er das republikanische Selbstverständnis Frankreichs in seiner alltäglichen Praxis untersucht und dabei dessen Erschöpfung sichtbar macht. Bégaudeau interessiert sich nicht für die großen Bruchstellen der Republik – Terror, Banlieue, religiöse Konflikte –, sondern für ihre Normalzonen: Schule, Familie, Freizeit, Verwaltung. Gerade dort, wo das System reibungslos zu funktionieren scheint, offenbart sich seine Leerstelle.
Die Schule ist der zentrale Ort dieser Diagnose. Sie erscheint im Roman nicht als repressives oder autoritäres System, sondern als korrekt arbeitende Institution, die ihre eigenen Regeln konsequent anwendet. Steve ist höflich, diszipliniert, er sagt „Bonjour Madame“, er deckt seine Gähner mit der Hand, er erfüllt formale Erwartungen. In den Protokollen der conseil de classe wird er nicht diffamiert, sondern sachlich beschrieben: „très poli“, „peu paresseux“, „manque d’investissement“. Diese Sprache ist emblematisch für die republikanische Meritokratie: Sie bewertet, klassifiziert, ordnet zu – und glaubt damit, gerecht zu sein. Doch genau diese gerechte Sprache erzeugt Distanz. Sie spricht über Steve, ohne je mit ihm zu sprechen.
Besonders aufschlussreich ist die wiederkehrende Szene des Unterrichts, in dem Steve korrekt antwortet oder korrekt nicht antwortet. Wenn er im Englischunterricht „I don’t know“ sagt, wird dies von der Lehrerin wohlwollend aufgenommen: Auch das Nichtwissen wird pädagogisch integriert. Doch diese Integration bleibt formal. Steve lernt, dass es genügt, eine funktionale Äußerung zu produzieren – nicht, sich selbst einzubringen. Die Schule fordert Teilnahme, aber keine Subjektivität. Sie ist damit der perfekte Ort für jemanden, der gelernt hat, unauffällig zu sein, und zugleich ein Ort, an dem genau diese Unauffälligkeit unsichtbar wird.
Die republikanische Meritokratie, die theoretisch Aufstieg durch Leistung verspricht, wird im Roman nicht offen widerlegt, sondern leise unterlaufen. Steve scheitert nicht spektakulär, er wird nicht systematisch benachteiligt. Er bleibt einfach zurück. Seine schulischen Schwierigkeiten – vor allem in abstrakten Fächern – werden als individuelles Defizit behandelt, nicht als Symptom. Die Institution reagiert mit Maßnahmen: Schulwechsel, Gespräche, Beobachtungen. Doch diese Maßnahmen greifen ins Leere, weil sie stets von der Annahme ausgehen, Steve sei ein rational adressierbares Subjekt, das nur „mehr investieren“ müsse. Dass ihm die Sprache fehlt, um sich selbst als Subjekt zu artikulieren, bleibt unbemerkt.
Besonders deutlich wird dies in der Szene des Gesprächs mit der Schulleitung, in dem die Eltern, höflich und kooperativ, versuchen, Steves Abwesenheiten zu erklären. Das Gespräch ist von republikanischer Vernunft durchzogen: Zahlen, Fehlzeiten, Gewicht, medizinische Abklärung. Alles wird erfasst, nichts wird verstanden. Steve sitzt dabei, spricht wenig, verspricht Besserung. Niemand lügt offen, niemand handelt böswillig. Und doch wird hier ein strukturelles Missverständnis sichtbar: Die Institution sucht nach Ursachen, wo es um Erfahrungen ginge; sie sucht nach Lösungen, wo es um Anerkennung ginge.
Auch das Ideal der laizistischen Neutralität ist präsent, als allgemeine Haltung der Nicht-Einmischung in Innerlichkeit. Die Schule, aber auch andere republikanische Räume, respektieren Steves Privatheit – so sehr, dass sie ihn nicht mehr sehen. Seine Isolation, sein Gewichtsverlust, seine zunehmenden Abwesenheiten werden registriert, aber nicht als Ausdruck einer existenziellen Krise gelesen. Die Republik ist hier nicht blind, sondern absichtlich neutral. Sie will nicht pathologisieren, nicht dramatisieren, nicht moralisieren. Doch diese Neutralität kippt in Gleichgültigkeit.
Ein besonders scharfer Kontrast entsteht in den Szenen kollektiver Gewalt unter Schülern, etwa in der systematischen Ausgrenzung Steves durch die ehemalige Clique. Diese Gewalt ist nicht spektakulär, sie besteht gerade im Nicht-Handeln: Man spricht nicht mehr mit ihm, man setzt sich woanders hin, man lässt Lücken. Diese soziale Unsichtbarmachung spiegelt strukturell das Verhalten der Institutionen. Was auf der Ebene der Jugendlichen als Grausamkeit erscheint, wiederholt sich auf institutioneller Ebene als bürokratische Indifferenz. Bégaudeau legt hier eine beunruhigende Analogie nahe, ohne sie explizit zu machen.
Die Republik erscheint so nicht als unterdrückende Macht, sondern als abwesender Gesprächspartner. Steve wird nicht aktiv ausgeschlossen, er wird nicht diskriminiert, er wird nicht einmal sanktioniert – bis zu dem Moment, in dem er selbst die Ordnung verletzt. Erst als er im Unterricht explodiert, die Lehrerin beschimpft, also die republikanische Sprache verlässt, wird er plötzlich sichtbar. Die Gewalt seiner Worte zwingt das System zur Reaktion. Doch diese Sichtbarkeit ist eine negative: Steve erscheint nun als Problem, als Störung, als Fall. Anerkennung gibt es nur um den Preis der Devianz.
Hier liegt eine politische Sprengkraft des Romans. Désertion zeigt eine Republik, die ihre Subjekte nicht verliert, weil sie sie unterdrückt, sondern weil sie sie nicht adressiert. Steve desertiert nicht aus Hass auf Frankreich, nicht aus ideologischer Opposition. Er verschwindet, weil es keinen Ort mehr gibt, an dem seine Erfahrungen Bedeutung haben. Die Radikalisierung – die der Roman nur andeutet, nie ausbuchstabiert – erscheint so nicht als Bruch mit der Republik, sondern als Fortsetzung ihrer Logik mit anderen Mitteln: klare Rollen, eindeutige Sprache, sichtbare Zugehörigkeit.
Bégaudeau entwirft damit ein Frankreichbild von erschreckender Nüchternheit. Die Republik funktioniert. Aber das ist das Problem.
Von der medialen Gemeinschaft zur absoluten Abwesenheit
Der Roman beginnt mit einem kollektiven Medienereignis: Star Academy. Millionen sehen dasselbe, fühlen dasselbe, stimmen ab. Steve ist Teil dieser Gemeinschaft, auch wenn sie flüchtig und illusionär ist. Der Beginn ist laut, bevölkert, übererklärt.
Der Schluss hingegen ist von radikaler Stille geprägt. Die Bewegung nach Raqqa wird nicht dramatisiert, nicht psychologisch ausgeschlachtet. Sie erscheint fast als logische Fortsetzung einer langen Reihe von Abwesenheiten. Wo der Roman beginnt, indem er zeigt, wie Gemeinschaft simuliert wird, endet er dort, wo Gemeinschaft vollständig durch Ideologie ersetzt ist.
Der Weg dazwischen ist keine Abweichung, sondern eine Desertion im wörtlichen Sinn: ein Verlassen jener symbolischen Ordnungen, die keinen Halt mehr boten.
Die Stärke von Désertion liegt zunächst in der unspektakulären Präzision, mit der Bégaudeau schulische Szenen modelliert. Der Unterricht erscheint nicht als Ort offener Gewalt, sondern als Raum der korrekt ausgeführten Routine. In einer scheinbar nebensächlichen Szene antwortet Steve auf eine Lehrerfrage mit einem sachlich richtigen, aber leblosen Satz; die Lehrerin nickt, trägt etwas in ihr Notizbuch ein, und der Unterricht geht weiter. Diese minimale Geste – Nicken, Notieren, Weitergehen – ist paradigmatisch für den Roman: Sie zeigt, wie Anerkennung in institutionelle Verwaltung umschlägt. Das Close Reading offenbart, dass die Sprache der Schule nicht verletzend ist, sondern entleert; sie zielt auf Klassifikation, nicht auf Beziehung. Bégaudeau gelingt hier eine literarische Darstellung dessen, was man als „sanfte Gewalt“ der Meritokratie bezeichnen könnte: Steve wird nicht beschämt, sondern korrekt verarbeitet. Gerade diese Korrektheit erzeugt jene Unsichtbarkeit, die der Roman als strukturelle Vorstufe der Desertion begreift.
In den Familienszenen verschiebt sich der Fokus von institutioneller Sprache zu affektiver Ökonomie. Besonders auffällig ist die wiederkehrende Beschreibung gemeinsamer Mahlzeiten, in denen gesprochen wird, ohne dass etwas verhandelt würde. Wenn der Vater beiläufig nach der Schule fragt und Steve ebenso beiläufig antwortet, entsteht eine Dialogform, die funktional ist, aber hermetisch bleibt. Ein Close Reading dieser Passagen zeigt, dass Bégaudeau bewusst auf dramatische Eskalationen verzichtet: Es gibt keine Schreie, keine Gewalt, keine offenen Konflikte. Stattdessen herrscht ein Klima der wohlmeinenden Vorsicht. Die Eltern wollen nichts falsch machen, und genau deshalb greifen sie nicht ein. Die Familie erscheint so als Verlängerung der republikanischen Logik: Respekt vor Autonomie ersetzt Sorge um Subjektivität. In dieser Zurückhaltung liegt keine emotionale Kälte, sondern eine kulturell erlernte Form der Distanz, die Steve schützt – und zugleich allein lässt.
Besonders subtil ist die mediale Dimension des Romans gestaltet, die im Close Reading als Gegenmodell zur institutionalisierten Kommunikation lesbar wird. Die Szene rund um Star Academy zu Beginn des Romans ist nicht bloß zeitgeschichtliche Markierung, sondern ein poetologischer Schlüssel. Hier herrscht eine andere Form von Ansprache: affektiv, rhythmisch, repetitiv. Steve schaut, hört zu, stimmt ab – und ist Teil eines Kollektivs, das keine individuelle Sprache verlangt. Bégaudeau beschreibt diese Medienerfahrung ohne Ironie, fast zärtlich. Das Fernsehen bietet das, was Schule und Familie nicht leisten: eine Form von Präsenz ohne Gegensprache, von Zugehörigkeit ohne Risiko. Im Close Reading zeigt sich, dass diese Medien nicht verführend im ideologischen Sinn sind, sondern entlastend. Sie ersetzen keine Realität, sie füllen eine Leerstelle. Genau darin liegt ihre ambivalente Funktion: Sie stabilisieren Steve kurzfristig, verhindern aber langfristig jede Entwicklung eigener Sprache.
In der Zusammenschau dieser Szenen erweist sich Désertion als Roman von ungewöhnlicher ethischer Konsequenz. Bégaudeau verzichtet konsequent auf psychologische Tiefenexplikation, auf moralische Anklage oder soziologische Erklärung. Stattdessen vertraut er auf die Aussagekraft minimaler Situationen: ein Unterrichtsmoment, ein Familiengespräch, ein Fernsehabend. Im Close Reading dieser Episoden zeigt sich, dass der Roman seine Bewertung nicht ausspricht, sondern strukturell vollzieht. Désertion ist kein Roman über Extremismus, sondern über Normalität – und gerade hierin politisch. Seine literarische Qualität liegt darin, dass er das Verschwinden eines Subjekts nicht dramatisiert, sondern nachvollziehbar macht. Am Ende bleibt kein Skandal, kein Schock, sondern eine Leerstelle. Die eigentliche Anklage des Textes.
Der Roman polarisiert die Literaturrezensenten: Johan Faerber und Marie Sorbier kritisieren in Radio France Culture 1 beide den Roman vor allem wegen eines Mangels an literarischer Qualität und an Empathie. Faerber bemängelt, dass das Buch politisch problematisch sei, da es ein falsches Bild vom Engagement junger Menschen zeichne und die Literatur zu einer Art „Halb-Wissenschaft“ degradiere. Er sieht einen fehlenden emotionalen Zugang und eine Abwesenheit von echten Figuren und Spannung, was die Wirkung des Romans stark einschränke. Ebenso kritisiert er soziale Herablassung und die eindimensionale, vorgegebene Erzählweise des Autors, die keinen Raum für eigene Reflexionen lasse. Marie Sorbier stimmt dieser Einschätzung zu und hebt hervor, dass das Fehlen von Emotion und Empathie das Buch politisch problematisch mache, weil es an der nötigen Betroffenheit gegenüber den dargestellten Jugendlichen fehle. Sie beschreibt den Roman als eine Aneinanderreihung soziologischer Klischees ohne literarische Tiefe und bemängelt, dass die Erzählung eher wie ein alter, ausgelutschter Kurs wirke, der nichts Neues produziere.
Valentin Hiegel 2 liest Désertion als bewusst ausweichenden Roman, der die Erwartungen an einen politischen oder sozialen „Stoff“ systematisch unterläuft. Zwar verspricht das Setting – zwei Brüder aus prekärem, ruralem Milieu, Syrien 2014, Daech im Hintergrund – eine klare Kausaldramaturgie, doch Bégaudeau verweigert genau diese Logik. Stattdessen entfaltet er eine Poetik der Exhaustivität: Schulmobbing, prekäre Arbeit, Liebesunfähigkeit oder popkulturelle Fixierungen werden in all ihren Wirkungen ausgebreitet, ohne je funktionalisiert zu werden. Der Roman kennt kein eigentliches „Sujet“, sondern stellt Subjektivitäten aus; er erzählt auf der Ebene von Wahrnehmung und Affekt und entzieht sich der sinnstiftenden Autorität eines erklärenden Erzählers. – Auch der Syrien-Teil sabotiert das Erwartbare: Keine jihadistische Radikalisierung, kaum Kampfhandlungen, sondern der Anschluss an das kurdische YPG, Gespräche, Alltag, widersprüchliche Diskurse. Die anarchistischen Ideen, die dort zirkulieren, erscheinen nicht als These des Romans, sondern als Stimmen unter anderen, die den Protagonisten nicht verwandeln. Hiegel deutet Désertion daher als Roman einer „anarchischen“ Sinnverweigerung im Sinne Frédéric Lordons: als Flucht aus Hierarchien, Teleologien und Bedeutungszwang. Am Ende hat sich nichts grundlegend geändert – und doch hat sich etwas ereignet, jenseits von Lehre, Moral oder Auflösung.
Der Titel Désertion ist in seiner semantischen Nüchternheit programmatisch und entfaltet im Verlauf des Romans eine vielschichtige Bedeutung, die weit über den militärischen Wortgebrauch hinausreicht. Zwar evoziert der Begriff zunächst das Bild eines bewussten, schuldhaften Verlassens – den Akt des Entzugs aus einer verbindlichen Ordnung –, doch Bégaudeau unterläuft diese Konnotation systematisch. Steves „Desertion“ ist kein heroischer Akt der Verweigerung und keine ideologische Entscheidung, sondern das Ergebnis eines allmählichen Herausfallens aus sozialen, sprachlichen und institutionellen Zusammenhängen. Im Close Reading der erzählten Situationen wird deutlich, dass Steve nicht desertiert, weil er sich abwendet, sondern weil er nirgends mehr adressiert wird: Schule, Familie und Öffentlichkeit verlieren ihn, lange bevor er sie verlässt. Der Titel markiert damit eine Verschiebung von der Tat zur Struktur. Désertion bezeichnet einen Prozess ohne Bruch, eine Erosion von Zugehörigkeit. Zugleich verweist der militärische Unterton des Begriffs auf eine paradoxe Logik moderner Gesellschaften: Sichtbar wird das Subjekt erst dann, wenn es die Ordnung verletzt. Indem Bégaudeau diesen Titel wählt, zwingt er dazu, Desertion nicht als Ausnahme, sondern als immanente Möglichkeit einer Republik zu lesen, deren Integrationsversprechen formal intakt, aber existenziell leer geworden ist.
Dieser Beitrag ist auf Deutsch verfasst unter https://rentree.de, es existieren automatische Übersetzungen in englischer und französischer Sprache: Englisch, Französisch.
Anmerkungen- Les midis de culture, 6. Januar 2026.>>>
- Valentin Hiegel, „Advienne que pourra“, En attendant Nadeau, 6. Januar 2026.>>>