Détruire tout (Éditions Inculte, 2025) von Bernard Bourrit rekonstruiert einen realen Feminizid in der Schweiz der 1960er-Jahre: Alain tötet seine Verlobte Carmen. Doch anstatt den Mord als isolierten Kriminalfall zu erzählen, verweigert Bourrit eine lineare, erklärende Darstellung. Ausgehend von Archiven, Zeitungsartikeln und Beobachtungen tastet sich der Erzähler an den Täter heran, ohne ihn psychologisch zu entschuldigen oder zu verurteilen. Alain erscheint weniger als individuelle Figur denn als Symptom: als Produkt einer Epoche, eines Milieus und eines sozialen Gefüges, das Gewalt hervorbringt, ohne sie offen zu benennen.
Zentral ist die Darstellung des ländlichen, patriarchal geprägten Umfelds, in dem Alain aufwächst. Die bäuerliche Schweiz erscheint als Raum der Enge, der Kontrolle und der unausgesprochenen Hierarchien: Familie, Dorf und Staat greifen ineinander und formen ein System, das Konformität erzwingt und Abweichung sanktioniert. Alkoholismus, autoritäre Erziehung und administrative Gewalt (etwa durch Zwangseinweisungen) werden nicht als direkte Ursachen, vielmehr als dauerhafte Hintergrundspannung gezeigt, die den Handlungsspielraum der Figuren zunehmend verengt.
Parallel dazu analysiert der Text die Geschlechterverhältnisse der Zeit. Carmen wird zur Projektionsfläche männlicher Erwartungen, weiblicher Idealisierung und gesellschaftlicher Normen. Bourrit macht deutlich, dass der Mord nicht aus „Eifersucht“ oder individueller Kränkung erklärbar ist, sondern aus einem zerstörerischen Verhältnis zur weiblichen Freiheit und zur eigenen Ohnmacht. Die fehlende Sprache für weibliche Selbstbestimmung und männliche Verletzlichkeit verschärft das Missverhältnis zwischen Begehren, Besitzdenken und Gewalt.
Formal spiegelt der Text diesen Ansatz wider: Er ist fragmentarisch, assoziativ und essayistisch. Die Sprache verweigert einfache Kausalitäten und zwingt die Leserinnen und Leser, Verantwortung nicht allein beim Täter zu verorten, die Verantwortung liegt im Zusammenspiel von Geschichte, Mentalitäten und Machtstrukturen. Détruire tout wird so zu einer literarischen Untersuchung darüber, wie Gesellschaften Gewalt ermöglichen – und wie Literatur diese sichtbar machen kann, ohne sie zu verharmlosen.
In Détruire tout wird Männlichkeit nicht als stabile Identität, Mannsein wird als brüchige, überforderte Konstruktion gezeigt, die sich im männlichen Körper einschreibt. Bourrit entwirft ein Bild von Männlichkeit, das zwischen Stärkeanspruch und innerer Ohnmacht taumelt und gerade aus dieser Spannung heraus destruktiv wird.
Der männliche Körper erscheint zunächst als Arbeits- und Funktionskörper. Alains Hände sind zugleich „musikalisch“ und gewalttätig: Sie könnten schöpfen, schaffen, berühren, werden aber in der bäuerlich-industriellen Realität zum Werkzeug des Fällens und Zerstörens. Der Körper ist trainiert für Härte, Ausdauer und Gehorsam, nicht für Zärtlichkeit oder Selbstreflexion. Diese Reduktion auf Nützlichkeit entleert den Körper seiner Ausdrucksmöglichkeiten und staut Affekte an, die sich nicht artikulieren dürfen.
Gleichzeitig wird Männlichkeit als hysterisch und verunsichert entlarvt. Alain verkörpert keine souveräne Virilität, es ist eher eine verletzte, krisenhafte Männlichkeit, die auf weibliche Autonomie mit Angst reagiert. Der männliche Körper ist hier kein Ort von Kontrolle, sondern von Kontrollverlust: Begehren schlägt in Besitzdenken um, Nähe in Bedrohung. Die Gewalt gegen Carmen entspringt nicht Stärke, sie entspringt der Unfähigkeit, das eigene Begehren und die eigene Abhängigkeit auszuhalten.
Schließlich zeigt Bourrit Männlichkeit als gesellschaftlich erzeugte Rolle, die durch paternale Macht, Dorföffentlichkeit und männliche Gemeinschaft stabilisiert wird. Der männliche Körper steht unter permanenter Beobachtung: Er muss funktionieren, leisten, „ein Mann sein“. Abweichung – Sensibilität, Scheitern, Passivität – wird sanktioniert oder lächerlich gemacht. Der Mord erscheint so als monströse Überaffirmation dieser Normen: als verzweifelter Versuch, durch Gewalt eine brüchige Männlichkeit zu retten.
Insgesamt demontiert Détruire tout das Ideal des starken, beherrschten Mannes. Der männliche Körper wird zum Austragungsort sozialer Zumutungen, historischer Gewalt und emotionaler Sprachlosigkeit – und damit zum Schauplatz einer Männlichkeit, die sich selbst zerstört, weil sie keine andere Form des Seins kennt.
Der Schluss von Détruire tout bietet weder eine psychologische Erklärung des Mordes noch eine moralische Katharsis. Stattdessen markiert er einen Punkt der Erschöpfung des Verstehens: Alles, was rekonstruiert, kontextualisiert und analysiert werden konnte, ist gesagt worden, ohne dass sich daraus Sinn, Rechtfertigung oder Trost ergeben hätten.
Zentral ist, dass der Text im Moment größter Nähe zwischen Alain und Carmen innehält – in jener Szene der ersten körperlichen Annäherung. Diese Geste wird nicht romantisiert, sondern als fragile Schwelle gezeigt: ein Augenblick, in dem alles noch offen ist und gerade deshalb „alles zerstört werden könnte“. Der Titel Détruire tout erhält hier seine volle Bedeutung: Zerstörung ist nicht das plötzliche Ereignis des Mordes, sondern eine Möglichkeit, die von Anfang an im Geflecht aus Begehren, Macht, Angst und gesellschaftlichen Erwartungen angelegt ist.
Der Schluss verweigert zudem eine Täterzentrierung. Indem der Erzähler nicht bis zur Tat selbst vordringt, entzieht er dem Gewaltakt seine spektakuläre Finalität. Die Aufmerksamkeit bleibt bei den Bedingungen, nicht beim Akt. Damit wird der Mord nicht zum erzählerischen Höhepunkt, er wird zur Leerstelle – als etwas, das sich der Darstellung entzieht, weil jede Darstellung Gefahr liefe, ihn zu normalisieren oder zu erklären.
Schließlich richtet sich der Schluss an die Leserinnen und Leser selbst. Die offene, schwebende Bewegung des Textes zwingt dazu, das Bedürfnis nach Erklärung, Schuldzuweisung oder Sinngebung zu hinterfragen. Détruire tout endet nicht mit einer Antwort, vielmehr mit einer ethischen Zumutung: anzuerkennen, dass Gewalt nicht „verstanden“ werden kann, ohne dass dieses Verstehen selbst Teil des Problems wird. Der Schluss ist damit auch Anklage gegen eine Gesellschaft, die solche Geschichten möglich macht, und gegen jede Erzählung, die sie beruhigend abschließen will.

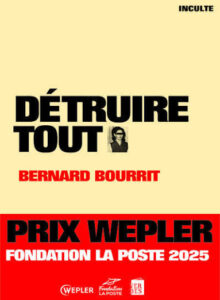






1 Gedanke zu „Zerstörung als Möglichkeit: Mannsein und Gewalt bei Bernard Bourrit“
Die Kommentare sind geschlossen.