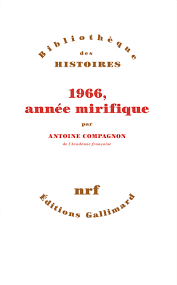Inhalt
- Als Theorie, Konsum und System den Menschen ersetzten
- Teil 1: Die neuen Intellektuellen
- Teil 2: Die Jugendkultur
- Teil 3: Rom und Moskau – Mauriac und Aragon
- Teil 4: Proust 66
- Teil 5: Ein kleiner modernistischer Ketzer – Barthes gegen Picard
- Teil 6: Theorie, Literatur, Politik
- Teil 7: Kinder der 1960er Jahre – Bresson, Morin, Godard
- Teil 8: Die Wende zur Textualität
- Teil 9: Malraux’ Schreckensjahr
- Teil 10: Der Tod des Menschen – Foucault gegen Sartre
- Teil 11: Althusser – Lacan
- Teil 12: Die Treblinka-Affäre
- Teil 13: Vor dem Mai
- Conclusion
Als Theorie, Konsum und System den Menschen ersetzten
Eingangs trage ich einige Fragen zusammen, die sich aus Compagnons Analysen des Jahres 1966 für unsere heutige Zeit, 60 Jahre danach, ergeben:
Sind unsere Hochschulen heute nur noch „Potemkin-Universitäten“? Compagnon zitiert zeitgenössische Kritiker, die 1966 beklagten, dass „falsche Studenten“ an „falschen Universitäten“ von „falschen Professoren“ für „falsche Prüfungen“ ausgebildet würden. Wenn wir heute über die Entwertung von Abschlüssen und die rein technokratische Verwaltung von Wissen klagen, müssen wir uns fragen: Haben wir das System der Massenbildung jemals über das Stadium einer bloßen Fassade hinausentwickelt, oder verwalten wir nur noch den 1966 eingeleiteten akademischen Niedergang?
War die Befreiung des Individuums in Wahrheit nur seine totale Unterwerfung unter das „System“? Foucault verkündete 1966 den „Tod des Menschen“ und ersetzte den gelebten Sinn durch die kalte Logik des Systems. In einer Ära, in der Algorithmen und Datenstrukturen unser Leben bestimmen, stellt sich die radikale Frage: Hat der Strukturalismus von 1966 uns nicht befreit, vielmehr die ideologische Blaupause für eine Welt geliefert, in der das Individuum nur noch eine bedeutungslose Variable in einem anonymen Netzwerk ist?
Ist unsere gesamte Kultur nur noch ein riesiges „Gadget“? Compagnon beschreibt 1966 als das Jahr, in dem Kultur durch das Taschenbuch und die Massenmedien zum Wegwerfartikel wurde, vergleichbar mit einem Einwegfeuerzeug. Müssen wir uns heute eingestehen, dass unser kultureller Konsum – vom Streaming bis zum Social-Media-Hype – nur die ultimative Steigerung dieser „Wegwerfkultur“ ist, in der das Zeichen wichtiger ist als der Inhalt und der Besitz eines prestigeträchtigen Objekts die echte Lektüre ersetzt?
Haben wir die Erinnerung an die Shoah dem Spektakel geopfert? Die „Affäre Treblinka“ von 1966 zeigte, dass das Schweigen über den Völkermord erst durch einen massiven Skandal und die Provokation der Opfer gebrochen werden konnte. Stellt uns das heute vor das Dilemma: Ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit historischem Trauma in einer Mediengesellschaft überhaupt noch ohne den Mechanismus der Skandalisierung und kommerziellen Verwertung möglich, wie ihn Steiner 1966 vorexerzierte?
War die „Jugendrebellion“ in Wahrheit nur die Geburtsstunde des perfekten Konsumenten? Compagnon legt dar, dass die Jugend 1966 weniger durch politische Ideale als durch ihre Kaufkraft und spezifische Konsumwünsche (Miniröcke, Transistoren, Poster) zu einer Klasse wurde. Müssen wir rückblickend feststellen, dass der gesamte Mythos der Revolte nur eine geschickte Marketingstrategie war, die den Weg für eine Gesellschaft ebnete, in der Widerstand heute selbst nur noch eine weitere Ware im Regal der Lifestyle-Industrie ist?
Antoine Compagnon entfaltet in seinem Panorama eines Jahres, 1966, année mirifique (Gallimard, 2026) seine Deutung eines Wunderjahres. Inspiriert von Victor Hugos Schilderung des Jahres 1817 in Les Misérables, möchte Compagnon das Wesen eines Jahrhunderts unter dem „Schaum der Tage“ aufspüren. Er durchforstet dafür die Presse, Literatur, das Radio, Fernsehen und die Mode, um die Form einer Epoche greifbar zu machen. Die Wahl fiel auf 1966, da dieses Jahr oft im Schatten des symbolmächtigen 1968 steht. Compagnon argumentiert jedoch, dass 1966 einen entscheidenden Wendepunkt darstellt, an dem sich langfristige Trends in Politik, Kultur und Gesellschaft kreuzten. Es ist das Jahr, in dem Frankreich endgültig in die Konsumgesellschaft eintritt und eine „zweite französische Revolution“ erlebt, die tiefgreifende Brüche in der Demografie und den Sitten einleitet. Der Autor nutzt einen zeitlichen Abstand von etwa sechzig Jahren, um eine kritische Distanz zu wahren und gleichzeitig die Tiefe dieser Zeit zu ergründen.
Das Buch versteht 1966 weniger als kalendarisches Jahr, vielmehr als kulturelle Saison, die bereits im Herbst 1965 beginnt. Es ist eine Zeit der institutionellen Normalisierung unter De Gaulle, aber auch der intellektuellen Unruhe. Während André Malraux mit seinen „Kulturhäusern“ moderne Kathedralen gegen die Sinnleere der Maschinenwelt errichtet und die Pille sowie neue Eherechte die rechtliche Befreiung der Frau einleiten, gärt unter der scheinbaren Stabilität des Gaullismus bereits die geistige Revolte, die im Skandal der Situationisten von Straßburg die Umbrüche des Mai 1968 präzise vorwegnimmt. Compagnon möchte aber zeigen, dass 1966 ein eigenständiges Gewicht besitzt, das nicht lediglich als bloßes Vorspiel zu 1968 abgetan werden kann. Das Vorhaben ist eine Mischung aus akribischer Archivarbeit und persönlicher Spurensuche eines Autors, der diese Zeit als Jugendlicher selbst miterlebte.
Das Jahr 1966 erweist sich auch als exakter Scheitelpunkt der wirtschaftlichen Prosperität, an dem Frankreich endgültig in die Konsumgesellschaft eintritt und die Jugend über Phänomene wie die Sammelwut von Werbe-Schlüsselanhängern oder den Minirock erstmals als eigenständige ökonomische Macht sichtbar wird. In diesem Jahr erreicht die massive Bevölkerungsexplosion die Universitäten und bringt eine neue Schicht von „neuen Intellektuellen“ hervor, während gleichzeitig die „Theorie“ zur neuen Leitwährung aufsteigt und Denker wie Michel Foucault mit der These vom „Tod des Menschen“ das humanistische Erbe Sartres in das Archiv des 19. Jahrhunderts verbannen. Es ist die Geburtsstunde der modernen Semiologie und einer radikalen Textualität, die das literarische Leben unter der Führung von Figuren wie Roland Barthes oder Philippe Sollers neu ordnet, während Marcel Proust durch die Massenverbreitung im Taschenbuch endgültig zum größten Schriftsteller der Moderne kanonisiert wird. Zugleich vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel im kollektiven Bewusstsein, indem die Shoah durch die Kontroversen um Jean-François Steiner und Hannah Arendt erstmals als einzigartiges Verbrechen in die französische Erinnerungskultur eintritt.
Teil 1: Die neuen Intellektuellen
Die Untersuchung beginnt mit der massiven Explosion der Studentenzahlen in den 1960er Jahren, die eine neue soziale Schicht hervorbrachte. Diese „neuen Intellektuellen“ umfassten nicht nur Akademiker, vielmehr auch eine wachsende Zahl von Angestellten und Technokraten, die durch Hochschulbildung geprägt waren. Diese Gruppe bildete das Kernpublikum für die aufkommenden Taschenbuchreihen und anspruchsvollen Nachrichtenmagazine wie L’Express.
Methodisch verknüpft Compagnon statistische Daten über das Bildungswesen mit literarischen Analysen, etwa von Georges Perecs Roman Die Dinge. Er zeigt auf, wie die Entwertung akademischer Titel und die Feminisierung des Lehrberufs den Status des Intellektuellen veränderten. Die Universität befand sich in einer permanenten Krise, da sie versuchte, elitäre Strukturen auf eine Massenausbildung zu übertragen.
Der Text beleuchtet zudem das Leiden dieser Generation, die Compagnon als „Kranke der Universität“ bezeichnet. Er nutzt Berichte von psychologischen Beratungsstellen für Studenten, um die Entfremdung und Zielosigkeit dieser neuen Schicht zu illustrieren. Literarische Figuren wie Adam Pollo in Le Clézios Das Protokoll dienen als Prototypen für diese verunsicherten jungen Menschen.
Der wesentliche Ertrag dieses Teils ist der Nachweis, dass der kulturelle Boom von 1966 ohne dieses neue Massenpublikum unmöglich gewesen wäre. Eine These Compagnons lautet, dass die Studenten der 1960er Jahre weniger durch Rebellion als durch eine spezifische Form der psychischen Entfremdung und soziale Deklassierung definiert waren. Zudem wird deutlich, dass die Reformen des Bildungswesens unter Christian Fouchet ungewollt den Boden für die Unruhen von 1968 bereiteten, indem sie traditionelle humanistische Grundlagen zerstörten, ohne neue berufliche Perspektiven zu schaffen.
Teil 2: Die Jugendkultur
Dieser Abschnitt widmet sich den sichtbaren Zeichen der Jugendkultur, wie langen Haaren, Miniröcken und der kuriosen Manie des Sammelns von Werbe-Schlüsselanhängern. Compagnon deutet diese Phänomene als Ausdruck eines euphorischen Optimismus in einer Zeit wirtschaftlicher Prosperität. Die Jugend wurde erstmals als eigenständige ökonomische Kraft mit spezifischem Kaufkraftpotential wahrgenommen.
Die Methode besteht hier in einer kulturwissenschaftlichen Analyse von Alltagsgegenständen und Massenmedien. Der Autor untersucht das Taschenbuch (livre de poche) als Konsumgut, das eine heftige Debatte über die Demokratisierung der Kultur auslöste. Er kontrastiert die elitäre Ablehnung dieser „Taschenbuchkultur“ durch Kritiker wie Hubert Damisch mit der pragmatischen Verteidigung durch Jean-Paul Sartre.
Zudem analysiert Compagnon die politische Instrumentalisierung der Jugend. Er beschreibt die Bemühungen des Ministers François Missoffe, eine nationale Jugendpolitik zu entwerfen, die jedoch am Unverständnis für die realen Probleme der jungen Generation scheiterte. Das Scheitern dieser technokratischen Planung wird am Beispiel der Konfrontation zwischen Missoffe und Daniel Cohn-Bendit greifbar.
Dieser Teil macht deutlich, dass die Jugend der 1960er Jahre primär über den Konsum und nicht über die Politik zu einer Klasse wurde. Eine überraschende These ist die Bedeutung des Einwegfeuerzeugs „Cricket“ als Symbol für den Übergang zur Wegwerfgesellschaft, das Sartre als Metapher für die neue Kultur diente. Der Ertrag liegt in der Erkenntnis, dass die sogenannte „Jugendrevolte“ ihre Wurzeln in einer tiefgreifenden Kommerzialisierung der Lebenswelt hatte.
Teil 3: Rom und Moskau – Mauriac und Aragon
Compagnon porträtiert die beiden „Literaturpäpste“ François Mauriac und Louis Aragon als die dominierenden Figuren des Jahres 1966. Während Mauriac den katholischen Gaullismus repräsentierte, verkörperte Aragon die intellektuelle Kraft der Kommunistischen Partei. Beide nutzten ihre enorme mediale Präsenz, um Einfluss auf das literarische und politische Geschehen zu nehmen.
Der Autor nutzt eine biografische und literaturgeschichtliche Methode, um die Parallelität dieser beiden Karrieren aufzuzeigen. Er beschreibt Mauriacs achtzigsten Geburtstag als nationales Ereignis und seinen Einsatz für De Gaulle während des Präsidentschaftswahlkampfs. Gleichzeitig wird Aragons Bemühen geschildert, das Erbe des Surrealismus mit dem Marxismus zu versöhnen und die Jugend für den Kommunismus zurückzugewinnen.
Besondere Aufmerksamkeit widmet Compagnon den privaten Krisen hinter der öffentlichen Fassade. Er analysiert einen erschütternden Brief von Elsa Triolet an Aragon aus dem Frühjahr 1966, der die Lüge ihrer mythisierten Liebesbeziehung entlarvt. Dieser Bruch spiegelt sich in der Struktur von Aragons Roman Blanche oder das Vergessen wider, der während dieser Zeit unterbrochen wurde.
Der Teil zeigt, wie sehr das literarische Leben noch von autoritären Vaterfiguren dominiert wurde, die gleichzeitig politische Ideologien stützten. Eine provokante These besagt, dass Aragon die Sprache der Avantgarde und des Strukturalismus nur deshalb übernahm, um die dogmatische Starre der KP zu kaschieren. Compagnon enthüllt hier ein tiefe Kluft zwischen der öffentlichen Inszenierung der „großen Autoren“ und ihrer inneren Verzweiflung angesichts des eigenen Alterns und politischer Desillusionierung.
Teil 4: Proust 66
In diesem Abschnitt wird die Renaissance von Marcel Proust im Jahr 1966 untersucht. Compagnon zeigt auf, wie Proust in diesem Moment endgültig zum „größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts“ kanonisiert wurde. Dieser Prozess fiel mit dem Verschwinden der letzten Zeitzeugen und dem Übergang zur rein wissenschaftlichen Analyse zusammen.
Die Methode ist hier rezeptionsgeschichtlich und medienkritisch. Der Autor analysiert die Wirkung einer großen Fernsehdokumentation über Proust, in der dessen Haushälterin Céleste Albaret zur eigentlichen Sensation wurde und den elitären Blick auf den Autor veränderte. Proust wurde durch Taschenbuchausgaben und Ausstellungen für ein Massenpublikum greifbar.
Gleichzeitig beschreibt Compagnon den Aufstieg der Proust-Forschung an der Universität, die sich von biografischen Anekdoten löste und strukturalistische Methoden übernahm. Die Biografie von George Painter löste eine heftige Kontroverse aus, da sie behauptete, das Werk könne nur durch das Leben verstanden werden – eine These, die von den neuen Kritikern wie Barthes provokant umgekehrt wurde.
Ein Ertrag dieses Teils ist die Einsicht, dass Proust 1966 an der Schnittstelle zwischen Hochkultur und Massenkonsum neu erfunden wurde. Ein Argument lautet hierbei, dass Céleste Albaret Proust „demokratisierte“, indem sie einen Zugang durch die „Dienstbotentreppe“ ermöglichte und so die mondäne Aura des Autors brach. Zudem wird gezeigt, dass die Hinwendung der Avantgarde zu Proust ein Zeichen für das Ende des Existentialismus war.
Teil 5: Ein kleiner modernistischer Ketzer – Barthes gegen Picard
Dieser Teil behandelt den berühmten Streit zwischen der „Nouvelle Critique“ und der traditionellen universitären Kritik der Sorbonne. Ausgelöst durch Roland Barthes‘ Werk über Racine, entbrannte eine Debatte über die legitime Interpretation klassischer Texte. Raymond Picard griff Barthes in einem Pamphlet scharf an und warf ihm „Imposture“ und ideologische Verblendung vor.
Compagnon nutzt eine soziologische Analyse, die sich auf Pierre Bourdieu stützt, um den Streit als reinen Machtkampf innerhalb des intellektuellen Feldes zu demaskieren. Es ging dabei weniger um die Wahrheit über Racine als vielmehr um die Vorherrschaft neuer Disziplinen wie der Semiologie über die klassischen Geisteswissenschaften. Barthes suchte die Allianz mit der Presse und den Studenten gegen die „Mandarine“ der Sorbonne.
Die methodische Verteidigung von Barthes in Kritik und Wahrheit wird als Wendepunkt zur modernen Texttheorie geschildert. Barthes forderte das Recht auf eine subjektive, systemische Lesart und lehnte die Idee einer objektiven philologischen Wahrheit ab. Er etablierte die Vorstellung, dass der Kritiker selbst zum Schriftsteller wird.
Der wesentliche Ertrag dieser Perspektie ist die Rekonstruktion eines Konflikts, der die pädagogischen Methoden der französischen Schulen und Universitäten für Jahrzehnte prägen sollte. Die zentrale These besagt, dass Barthes und Picard trotz ihrer Feindschaft Komplizen bei der Verteidigung des literarischen Kanons waren. Überraschend ist die Beobachtung Bourdieus, dass Barthes den archaischen Zustand der Universität nur nutzte, um eine neue, technokratische Routine zu etablieren.
Teil 6: Theorie, Literatur, Politik
Compagnon analysiert hier den Aufstieg der „Theorie“ zur neuen Leitdisziplin. Er beschreibt, wie das Denken von der Existenz zum Konzept und vom Sinn zum System überging. 1966 war das Jahr, in dem der Strukturalismus die Medien eroberte, obwohl die Protagonisten dieses Etikett oft ablehnten.
Methodisch untersucht der Autor die Einführung des russischen Formalismus in Frankreich durch Tzvetan Todorovs Anthologie Theorie der Literatur. Er zeigt auf, wie diese Texte instrumentalisiert wurden, um eine neue Genealogie für den Strukturalismus zu schaffen. Die Verbindung zwischen Linguistik und Literatur wurde zum Kernstück des neuen intellektuellen Selbstverständnisses.
Ein weiterer Fokus liegt auf der politischen Dimension dieser Theoriebildung. Innerhalb der Kommunistischen Partei wurde der Formalismus als Waffe gegen den erstarrten sozialistischen Realismus eingesetzt. Aragon und Pierre Daix förderten diese Strömungen, um die Partei kulturell zu modernisieren, ohne den Marxismus ganz aufzugeben.
Der Teil verdeutlicht, dass die „Theorie“ 1966 zur eigentlichen Religion der Intellektuellen wurde. Eine wichtige These ist die Aufdeckung der „geschönten“ Geschichte des Strukturalismus, die Roman Jakobson als universellen Vermittler inszenierte und dabei Brüche innerhalb der russischen Schule verschwieg. Der Ertrag liegt in der Erkenntnis, dass wissenschaftliche Rigorosität oft als Deckmantel für innerparteiliche Machtkämpfe diente.
Teil 7: Kinder der 1960er Jahre – Bresson, Morin, Godard
Compagnon vergleicht in diesem Abschnitt das Filmschaffen von Robert Bresson und Jean-Luc Godard sowie die soziologische Arbeit von Edgar Morin. Alle drei näherten sich der Jugend von 1966 auf unterschiedliche Weise, zwischen Metaphysik und Feldforschung. Bressons Zum Beispiel Balthazar und Godards Masculin – Féminin werden als komplementäre Studien über die moderne Entfremdung gelesen.
Die Methode verbindet Filmanalyse mit der Untersuchung soziologischer Praktiken wie dem Interview. Morin führte eine Feldstudie im bretonischen Plozévet durch, um den gewaltsamen Einbruch der Moderne in eine traditionelle Gemeinschaft zu dokumentieren. Er identifizierte Frauen und Jugendliche als die eigentlichen Motoren dieses Wandels.
Godard wiederum nutzte das „Kino-Wahrheit“ (Cinéma-vérité), um die Generation von „Marx und Coca-Cola“ zu porträtieren. Sein Film wird als soziologischer Essay gedeutet, der die Kluft zwischen politisierten Jungen und konsumorientierten Mädchen aufzeigt. Er „kollagierte“ die Wirklichkeit von 1966 direkt in seine fiktive Handlung.
Ein Ertrag dieses Teils ist der Nachweis einer tiefen Verwandtschaft zwischen dem „antimodernen“ Bresson und dem „modernen“ Godard in ihrer Ablehnung des kommerziellen Kinos. Eine überraschende These lautet, dass die Schule in den 1960er Jahren aufhörte, der primäre Motor der Modernisierung zu sein, und stattdessen von der Konsumkultur überholt wurde. Zudem wird deutlich, wie sehr das Interview als neue literarische und wissenschaftliche Form das Jahr prägte.
Teil 8: Die Wende zur Textualität
Dieser Abschnitt beleuchtet den Bruch zwischen der Zeitschrift Tel Quel und dem „Nouveau Roman“. Philippe Sollers wandte sich von Alain Robbe-Grillet ab und proklamierte eine radikale Textualität, die das Schreiben als „Erfahrung der Grenzen“ begriff. Damit vollzog die Avantgarde den Übergang vom psychologischen Realismus zur rein sprachlichen Untersuchung.
Methodisch analysiert Compagnon die programmatischen Texte von Sollers und die theoretische Neuausrichtung von Barthes. Er zeigt, wie Figuren wie Sade, Artaud und Bataille zu den neuen Leitsternen erhoben wurden. Die Literatur sollte nicht mehr die Welt repräsentieren, jedoch ihre eigene Entstehung reflektieren.
Im Gegensatz zu dieser theoretischen Kälte wird das Schaffen von Marguerite Duras als eine Form des Romans dargestellt, die trotz aller Experimente eine emotionale Tiefe bewahrte. Ihr Werk Der Vizekonsul markierte einen Höhepunkt ihrer Karriere und wurde sogar von Jacques Lacan als prophetisch gelobt. Duras wurde zur eigentlichen Ikone des Jahres 1966.
Der Ertrag dieses Abschnitts liegt in der Rekonstruktion einer Radikalisierung der Avantgarde, die sich zunehmend von der Leserschaft entfernte. Eine zentrale These ist das Ende des „Nouveau Roman“ als reformistisches Projekt des Bürgertums und sein Ersatz durch eine aggressive „Theorie des Textes“. Überraschend ist die Feststellung, dass Duras’ Erfolg darauf beruhte, dass sie die Kolonialgeschichte auf eine Weise verarbeitete, die für das moderne Publikum des Jahres 1966 anschlussfähig war.
Teil 9: Malraux’ Schreckensjahr
Compagnon schildert 1966 als ein Krisenjahr für André Malraux, den Minister für Kulturangelegenheiten. Malraux war politisch durch Zensurstreitigkeiten um Rivettes Film Die Nonne und Genets Stück Die Wände unter Druck geraten. Gleichzeitig befand er sich in einer tiefen persönlichen Depression und arbeitete heimlich an seinen Antimémoires.
Die Methode besteht in der Gegenüberstellung von Malraux’ glanzvollen öffentlichen Reden und seiner privaten Zerrüttung. Der Autor analysiert Malraux’ Vision der „Kulturhäuser“ (Maisons de la Culture) als moderne Kathedralen, die dem Leben in der Maschinenwelt wieder einen Sinn geben sollten. Malraux lehnte jede pädagogische Vermittlung ab und glaubte an den unmittelbaren „ästhetischen Schock“.
Zudem wird das Zerwürfnis mit Pierre Boulez thematisiert, das zur Emigration des Komponisten aus Frankreich führte. Malraux wurde als „Kulturminister“ (mit K) verspottet, der zwar große Visionen habe, jedoch bei praktischen Reformen und im Kampf gegen die Zensur versage. Sein Rückzug in das Schreiben der Memoiren wird als Flucht vor der unbewältigten Gegenwart gedeutet.
Der Teil zeigt das Paradox eines Ministers, der die Freiheit der Kunst rühmt, während seine Regierung sie unterdrückt. Eine überraschende These ist der Vergleich zwischen Kultur und Autobahnbau, mit dem Malraux versuchte, sein Budget vor dem Parlament zu rechtfertigen. Der Ertrag liegt in der Erkenntnis, dass Malraux’ eigentliches Vermächtnis des Jahres 1966 nicht seine Politik war, vielmehr die Neuerfindung der literarischen Form des „Antimemoir“.
Teil 10: Der Tod des Menschen – Foucault gegen Sartre
Dieser Abschnitt widmet sich dem überwältigenden Erfolg von Michel Foucaults Die Ordnung der Dinge. Das Buch wurde zum Symbol für das Ende des Existenzialismus und den Aufstieg des Strukturalismus. Foucaults These vom „Tod des Menschen“ erschütterte die humanistischen Grundlagen sowohl der christlichen als auch der marxistischen Philosophie.
Methodisch zeichnet Compagnon die mediale Inszenierung Foucaults nach und konfrontiert sie mit Sartres bitterer Kritik. Sartre sah im Strukturalismus die „letzte Barrikade des Bürgertums“ gegen den Marxismus und warf Foucault vor, die Geschichte durch ein statisches System zu ersetzen. Foucault hingegen betrachtete Sartre als einen Denker des 19. Jahrhunderts, der unfähig sei, die moderne Episteme zu begreifen.
Der Autor beleuchtet auch die technokratische Dimension von Foucaults Denken. Kritiker wie Henri Lefebvre sahen im Strukturalismus die adäquate Ideologie für die neue Schicht der Planer und Experten unter De Gaulle. Foucault selbst war in dieser Zeit eng mit Regierungsstellen verbunden und beteiligte sich an Universitätsreformen.
Die Darstellung eines radikalen Epochenwechsels im französischen Denken findet in diesem Teil statt. Eine zentrale These lautet hierbei, dass Foucaults Erfolg darauf beruhte, dass er ein Bedürfnis nach wissenschaftlicher Strenge bediente, das die „Moralpredigten“ Sartres ablöste. Überraschend ist die Einordnung des Marxismus durch Foucault als bloßes Randphänomen des 19. Jahrhunderts, das in der modernen Welt keine Luft mehr bekomme.
Teil 11: Althusser – Lacan
Compagnon untersucht die ungewöhnliche Allianz zwischen dem Marxisten Louis Althusser und dem Psychoanalytiker Jacques Lacan. Beide arbeiteten an einer radikalen Erneuerung ihrer Disziplinen durch eine „Rückkehr zu den Quellen“ und die Ablehnung jeglichen Humanismus. Diese Verbindung prägte eine ganze Generation von Elite-Studenten an der École normale supérieure.
Die Methode ist hier ideengeschichtlich und organisationssoziologisch. Der Autor beschreibt die Kämpfe innerhalb der kommunistischen Studentenorganisation UEC, in denen althussersche Strenge gegen „revisionistische“ Tendenzen ausgespielt wurde. Die Veröffentlichung von Lacans Schriften und Althussers Für Marx im selben Jahr zementierte ihre intellektuelle Vorherrschaft.
Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle der „Theorie“ als politisches Instrument. Während der Parteivorstand der KP versuchte, einen christlich-marxistischen Humanismus zu etablieren, beharrte Althusser auf der „theoretischen Antihumanität“ von Marx. Lacan wiederum nutzte die Sprachwissenschaft, um den Freudianismus von seinen biologischen Missverständnissen zu befreien.
Dieser Teil zeigt, wie die Verbindung von Marx und Freud zur neuen intellektuellen Orthoxodie wurde. Eine zunächst überraschende These ist, dass Althusser Lacan als „Vaterfigur“ akzeptierte, während er gleichzeitig versuchte, die Studentenbewegung für die Parteilinie zu disziplinieren. Ein Ertrag liegt in der Analyse der „Cahiers pour l’analyse“ als Keimzelle eines Denkens, das den Strukturalismus bereits wieder hinter sich lassen wollte.
Teil 12: Die Treblinka-Affäre
In diesem Abschnitt wird die Kontroverse um Jean-François Steiners Buch Treblinka thematisiert. Das Werk löste eine heftige Debatte über die angebliche Passivität der Juden während der Vernichtung aus. Steiner wurde vorgeworfen, die Opfer zu verhöhnen und antisemitische Klischees von der „jüdischen Feigheit“ zu bedienen.
Die Methode verknüpft literarische Kritik mit Zeitgeschichte und Moralphilosophie. Compagnon setzt das Buch in Beziehung zu Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem, dessen französische Übersetzung zur gleichen Zeit erschien und ähnliche Vorwürfe der Kollaboration jüdischer Räte erhob. Er zeigt auf, wie diese Debatten das Bewusstsein für die Einzigartigkeit der Shoah in Frankreich schärften.
Trotz der berechtigten historischen Kritik an Steiners fiktionalisierten Dialogen und falschen Zahlen, erkennt Compagnon dem Buch eine katalytische Wirkung zu. Es brach das Schweigen über die Vernichtungslager und zwang die Öffentlichkeit, sich mit der Realität der industriellen Tötung auseinanderzusetzen. Bedeutende Intellektuelle wie Pierre Vidal-Naquet erlebten durch dieses Werk eine persönliche und fachliche Zäsur.
Eine Erkenntnis aus diesem Teil ist, dass 1966 das Jahr war, in dem die Shoah in das französische Gedächtnis eintrat. Eine zentrale These besagt, dass Steiners „skandalöse“ Fragestellung notwendig war, um das heroische Narrativ der Résistance zu durchbrechen und die spezifische Situation der jüdischen Opfer sichtbar zu machen. Überraschend ist hierbei die Feststellung, dass Steiner von der extremen Rechten instrumentalisiert wurde, während er gleichzeitig versuchte, ein neues jüdisches Selbstbewusstsein zu begründen.
Teil 13: Vor dem Mai
Der abschließende Teil fasst das Jahr als eine „Bestandsaufnahme“ zusammen, die unmittelbar in die Unruhen von 1968 mündet. Ereignisse wie De Gaulles Rede in Phnom Penh gegen den Vietnamkrieg und der Aufstieg von Yves Saint Laurents Prêt-à-porter markieren den globalen und gesellschaftlichen Aufbruch. Die alten Eliten feiern sich noch einmal selbst, während die Jugend bereits eigene Wege geht.
Compagnon erstellt hier eine chronologische Collage der letzten Monate des Jahres. Der Autor beschreibt den Skandal um die Situationisten in Straßburg als eine perfekte Vorwegnahme des Mai 1968. Ihr Pamphlet Über das Elend im Studentenmilieu griff alle Idole des Jahres an und forderte ein Leben ohne „tote Zeiten“ und Genuss ohne „Fesseln“.
Compagnon beendet das Buch mit einer persönlichen Rückschau auf seine eigene Rückkehr nach Frankreich im August 1965. Er verknüpft seine „Ego-Geschichte“ mit den großen Themen des Buches und gesteht, dass 1966 für ihn das Jahr der Entdeckung einer neuen Welt war. Das Jahr erscheint als ein Moment der totalen Verfügbarkeit und des Übergangs.
Dieser Schluss bekräftigt die Ausgangsthese, dass 1966 ein eigenständiges „Wunderjahr“ war, dessen Reichtum nicht auf 1968 reduziert werden kann. Compagnon argumentiert, dass die eigentliche Revolution bereits in den Köpfen und im Konsumverhalten von 1966 stattgefunden hatte und 1968 nur noch der politische Ausbruch war. Der Teil macht deutlich, dass die scheinbare Stabilität unter De Gaulle bereits von tiefen Rissen durchzogen war.
Conclusion
Compagnon integriert internationale Kontexte vorwiegend als Spiegelbilder oder Katalysatoren für französische Entwicklungen, wobei die USA häufig als Maßstab für moderne Konsum- und Medienkulturen auftreten, während Deutschland vor allem über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit präsent bleibt. Die schleichende „Amerikanisierung“ der französischen Öffentlichkeit dokumentiert der Autor etwa anhand der neuartigen Fernseh-Wahlkämpfe oder der Transformation von Nachrichtenmagazinen nach US-Vorbild. Kulturell stehen die „Kinder von Marx und Coca-Cola“ für das Spannungsfeld zwischen politischen Idealen und globaler Popkultur, was sich ebenso in der symbolischen Aufladung der Route 66 wie im triumphalen Erfolg französischer Theorie-Exporte an der Johns Hopkins University manifestiert. Deutschland tritt einerseits durch die intellektuelle Kritik Hans Magnus Enzensbergers an der Taschenbuchkultur in Erscheinung. Andererseits bleibt der deutsche Bezugsrahmen für die sich wandelnde Wahrnehmung der Shoah unumgänglich, sei es durch die juristische Aufarbeitung in den Düsseldorfer Prozessen oder die provokante Rezeption von Hannah Arendts Thesen zur „Banalität des Bösen“. Compagnon verwendet diese internationalen Referenzen nicht als isolierte Exkurse, vielmehr dienen sie als unverzichtbare Koordinaten, um die Radikalität des Jahres 1966 innerhalb einer vernetzten westlichen Welt zu verorten.
Die etablierten Größen der französischen Geisteswelt wie Jean-Paul Sartre, André Malraux, François Mauriac und Louis Aragon reagieren auf ihre drohende Verdrängung durch die aufstrebenden Strukturalisten mit einer Mischung aus bitterem Widerstand, schöpferischem Rückzug und verzweifelten Verjüngungsversuchen. Sartre sieht sich plötzlich als „Has-been“ abgestempelt und verteidigt die Geschichte sowie die menschliche Praxis leidenschaftlich gegen das neue Primat des Systems, das er als „letzte Barrikade des Bürgertums“ gegen den Marxismus diffamiert. Während Malraux angesichts persönlicher Krisen und öffentlicher Angriffe in eine tiefe Depression verfällt und sich in die Arbeit an seinen Antimémoires flüchtet, versucht Aragon, durch einen demonstrativen „Jeunismus“ und die Allianz mit der Avantgarde von Tel Quel den Anschluss an die neue Zeit zu wahren. Mauriac hingegen lässt sich zwar als nationales Monument feiern, empfindet sich jedoch selbst als eine Art „Mammut“ oder „Aurochs“, das die Jugend und ihre neuen Sitten nicht mehr wirklich versteht.
Compagnon deutet die Entthronung dieser Generation als einen radikalen epistemologischen Bruch, bei dem der Humanismus des 19. Jahrhunderts durch die „Theorie“ und das kalte System ersetzt wird. Die Anliegen der älteren Intellektuellen, die um Begriffe wie Sinn, Freiheit und gelebtes Schicksal kreisen, wirken in den Augen der Neuen plötzlich provinziell und wissenschaftlich unzureichend. Michel Foucault verweist Sartre und seine Zeitgenossen mit der These vom „Tod des Menschen“ direkt ins Museum der Geistesgeschichte, da sie unfähig seien, die modernen Strukturen jenseits des Bewusstseins zu begreifen.
Compagnon betrachtet die Entstehung dieser Gruppe neuer Intellektueller mit einer deutlichen Skepsis, da sie für ihn untrennbar mit einer krisenhaften „Vermassung“ der Bildung verbunden ist. Er beschreibt diese Schicht als oft „orientierungslos“ und nutzt den Begriff der „Kranken der Universität“, um eine Generation zu charakterisieren, die in einem System von „Potemkin-Universitäten“ gefangen war. Die Folgen dieser Entwicklung sieht er darin, dass eine akademische Scheinwelt entstand, in der „falsche Studenten“ von „falschen Professoren“ für „falsche Prüfungen“ ausgebildet wurden. Der Aufstieg der strukturalistischen Theorie diente dieser neuen Elite dabei als eine Art „technokratische Religion“, welche die traditionelle humanistische Bildung verdrängte und durch eine neue, oft sterile akademische Routine ersetzte, die das Denken eher verwaltete als befreite.
Die langfristigen Auswirkungen dieser Epoche bewertet Compagnon als eine verhängnisvolle Weichenstellung, da die Reformen von 1966 – insbesondere die Abschaffung des allgemeinbildenden ersten Studienjahres – eine dauerhafte „Zerstückelung“ des Hochschulwesens einleiteten. Diese Generation der „Kinder von Marx und Coca-Cola“ vollzog eine folgenschwere Verbindung von intellektuellem Anspruch und Massenkonsum, wodurch Kultur zu einer bloßen Ware, einem verfügbaren „Gadget“, degradiert wurde. Anstatt eine echte soziale Öffnung zu erreichen, zementierte die neue intellektuelle Praxis lediglich neue Hierarchien und ebnete den Weg für eine konsumorientierte Beliebigkeit, die das Erbe der klassischen Geisteswissenschaften bis in die Gegenwart hinein schwächt.
Trotz dieser kritischen Diagnosen plädiert Compagnon nicht für eine Rückabwicklung dieser Prozesse, da er 1966 als eine unvermeidliche Schwelle zwischen zwei Epochen begreift. Er betont die „Ungleichzeitigkeit der Zeitgenossen“ und zeigt auf, dass das Jahr 1966 ein Moment war, in dem sich langfristige Trends (Demografie, Ökonomie, Sitten) unumkehrbar kreuzten. Das Buch endet nicht mit einer Forderung nach Restauration, vielmehr mit der Frage, was wir diesem Jahr heute schulden. Compagnon macht deutlich, dass die von ihm beschriebene „zweite Revolution“ noch gar nicht abgeschlossen ist und unsere digitale, konsumorientierte Gegenwart direkt aus den Weichenstellungen von 1966 hervorgegangen ist.
Compagnon blickt mit der Schärfe des Historikers und der Melancholie des Zeitzeugen auf 1966 zurück. Er deckt die Illusionen und die psychische Entfremdung der damaligen Jugend sowie die Arroganz der neuen Theorie-Eliten auf. Doch anstatt zur Umkehr aufzurufen, fordert er den Leser dazu auf, die Form unserer eigenen Epoche besser zu verstehen, indem wir ihre Ursprünge in diesem „wunderbaren“ wie schrecklichen Jahr des Übergangs studieren.
Ein problematischer Aspekt in Compagnons Darstellung ist die Dominanz einer männlich geprägten intellektuellen Elite, die das Jahr 1966 fast ausschließlich durch die Perspektive „großer Männer“ wie Mauriac, Aragon, Malraux oder Sartre definiert. Compagnon räumt zwar ein, dass 1966 ein entscheidendes Jahr für die rechtliche und sexuelle Befreiung der Frau war – etwa durch das Gesetz zur finanziellen Unabhängigkeit und die Debatten um die Pille –, doch bleiben Frauen in seiner Analyse oft soziologische Objekte oder „Agentinnen der Modernisierung“, statt als eigenständige intellektuelle Akteure aufzutreten. Er stellt selbst fest, dass fast alle maßgeblichen Akteure der Zeit Männer waren, was dazu führt, dass der Feminismus eher als eine Begleiterscheinung des Konsums und der Demografie behandelt wird, während die tiefgreifende intellektuelle Auseinandersetzung mit patriarchalen Strukturen hinter den Debatten über den Strukturalismus zurücktritt.
Zudem erscheinen die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und die Marginalisierung der Homosexuellenbewegung als unzureichend vertiefte Themenkomplexe. Zwar finden koloniale Bezüge über die Ben-Barka-Affäre, den Vietnamkrieg und die Rezeption von Duras’ Werken Eingang in den Text, doch fungiert das postkoloniale Trauma oft nur als ästhetische oder politische Kulisse für die Pariser Intelligenz. Ein echter blinder Fleck ist die fehlende Würdigung der Homosexuellenbewegung als politische Kraft; Homosexualität wird bei Compagnon primär im Rahmen von persönlichen Skandalen, wie dem Briefwechsel zwischen Peyrefitte und Mauriac, oder als ästhetisches Stigma bei Proust verhandelt. Der Fokus liegt massiv auf der „epistemologischen Revolution“ und dem Pariser Zentrum, was die Lebensrealitäten und Kämpfe am Rande dieser theoretischen Diskurse – trotz des interessanten Exkurses in die ländliche Bretagne – eher als anekdotisches Beiwerk erscheinen lässt.
Antoine Compagnons 1966, année mirifique ist wie gezeigt mehr als eine bloße Chronik; es ist die Rekonstruktion eines epistemologischen Bruchs. Das Jahr markiert den Moment, in dem der Humanismus des 19. Jahrhunderts und die existenzialistische Verantwortung des 20. Jahrhunderts durch die kalte Eleganz des Systems, des Zeichens und des Marktes abgelöst wurden. Es ist das Jahr, in dem die Jugend als ökonomische Klasse geboren wurde und die „Theorie“ zur neuen kulturellen Währung aufstieg. De Gaulle herrschte zwar noch unangefochten, jedoch waren die Fundamente seiner moralischen Ordnung bereits unterspült: durch die Pille, das Taschenbuch und den Strukturalismus. Die Arbeit zeigt, dass 1966 die eigentliche Schaltstelle der französischen Moderne ist. Hier wurden die Weichen für die Identitätspolitik, die Erinnerungskultur und die mediale Inszenierung von Intellektualität gestellt, die wir heute kennen.